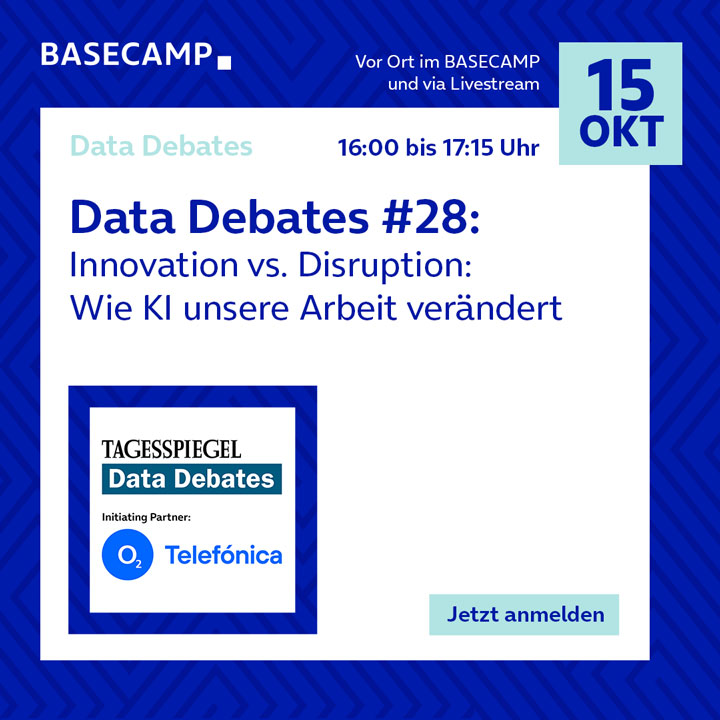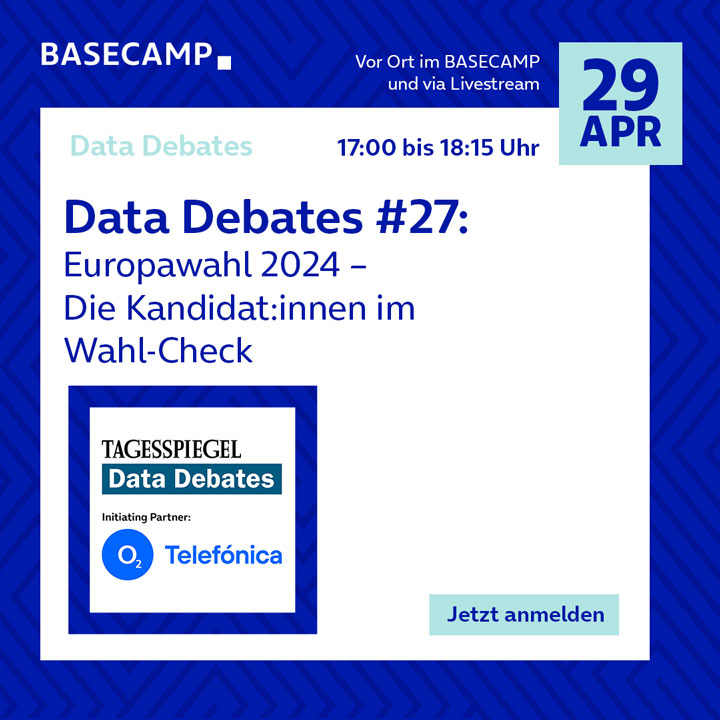Digitalpolitischer Jahresausblick: Die EU-Vorhaben für 2024


2024 steht mit der Europawahl ein entscheidendes Ereignis auf der EU-Ebene an. Wir fassen zusammen mit welchen digitalpolitischen Entscheidungen in Brüssel und Straßburg bis zur Wahl sowie danach zu rechnen ist.
Bis zur Europawahl, die vom 6. bis 9. Juni in den 27 Mitgliedstaaten stattfinden wird, bleiben den EU-Institutionen noch ein paar Monate, um bereits begonnene Gesetzesvorhaben abzuschließen. Dazu gehören auch mehrere digitalpolitische Projekte, denn auf diesem Feld ist die EU-Ebene besonders relevant. So wurden in der jüngeren Vergangenheit bereits einige wichtige Gesetze verabschiedet, die großen Einfluss auf die Gestaltung der digitalen Sphäre in Europa haben. Als Beispiele allein aus der aktuellen Legislaturperiode seien hier nur der Digital Services Act, der Digital Markets Act und der AI Act genannt.
Regulierung Künstlicher Intelligenz
Die EU-Kommission hatte bereits im Oktober ihr Arbeitsprogramm für 2024 (öffnet in neuem Tab) angekündigt. Aufgrund der auslaufenden Legislaturperiode und begrenzten Zeit bis zur Europawahl beinhaltet es aber nur wenig neue Initiativen, z.B. eine für „europäische Supercomputerkapazitäten für ethische und verantwortungsbewusste Start-ups im Bereich der künstlichen Intelligenz“. Ansonsten geht es vor allem darum, bereits initiierte Vorhaben zum Abschluss zu bringen.
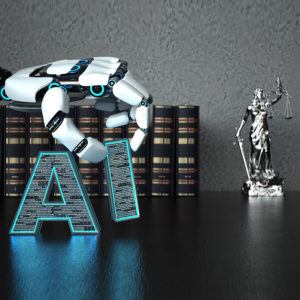
Dazu zählt besonders der Artificial Intelligence Act (AI Act), der KI-Anwendungen in der EU regulieren soll und bei dem es Anfang Dezember einen Durchbruch (öffnet in neuem Tab) nach intensiven Trilog-Verhandlungen gab. Dem vereinbarten Ergebnis müssen das EU-Parlament und der Europäische Rat nun nur noch formal zustimmen. Dies dürfte voraussichtlich vor der Europawahl passieren. Vollständig in Kraft treten wird der AI Act aber erst zwei Jahre später, auch wenn nach sechs Monaten schon diverse Verbote und nach zwölf Monaten die Regeln für General Purpose AI gelten sollen.
DSA und DMA werden vollständig gültig
Wesentlich weiter sind hingegen die Prozesse beim Digital Services Act (DSA) und beim Digital Markets Act (DMA): Ab dem 17. Februar 2024 gelten die Vorgaben des DSA (öffnet in neuem Tab) auch für kleinere Online-Dienste, nachdem sich sehr große Plattformen (basierend auf der Zahl der monatlich aktiven User) bereits seit August 2023 daran halten sollen. Ab dem 7. März müssen zudem die von der EU-Kommission benannten Gatekeeper (öffnet in neuem Tab), wie Amazon, Apple, Meta oder Microsoft, alle Gebote und Verbote des DMA einhalten.
Im neuen Jahr werden laut EU-Kommission darüber hinaus einige weitere Vorhaben mit Digitalbezug finalisiert bzw. in Kraft treten: Das Cyberresilienzgesetz (öffnet in neuem Tab), die elektronische Brieftasche (öffnet in neuem Tab) für die europäische digitale Identität (EUid) sowie das europäische Medienfreiheitsgesetz (öffnet in neuem Tab) stehen kurz vor der endgültigen Verabschiedung. Die EU-Staaten müssen zudem bis Oktober 2024 die NIS2-Richtlinie (öffnet in neuem Tab) zur Cyber- und Informationssicherheit von Unternehmen und Institutionen jeweils in nationales Recht umsetzen.
Finaler Data Act, umstrittene Chatkontrolle
Am 11. Januar ist nun der Data Act (öffnet in neuem Tab) in Kraft getreten, der einen Binnenmarkt für Daten schaffen und die Nutzung persönlicher Daten regulieren soll. Er wird allerdings erst in 20 Monaten vollständig angewendet werden. Zudem könnten die Trilog-Verhandlungen zum Europäischen Raum für Gesundheitsdaten (öffnet in neuem Tab) demnächst beginnen. Fortschritte gibt es auch beim Projekt des digitalen Euro (öffnet in neuem Tab), bei dem im November der erste zweijährige Teil einer Vorbereitungsphase gestartet ist.
Beim viel diskutierten Vorhaben der Chatkontrolle ist eine politische Einigung derzeit hingegen nicht in Sicht (öffnet in neuem Tab), obwohl im August 2024 die bisherige Interimsregelung auslaufen wird. Da sich die Verhandlungen über eine neue Verordnung aufgrund von Uneinigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten hinziehen und dann auch noch der Trilog zwischen den drei EU-Institutionen ansteht, hat die Kommission vorgeschlagen, die aktuelle Übergangsregelung zum freiwilligen Scannen nach Inhalten sexualisierter Gewalt gegen Kinder um zwei Jahre zu verlängern.

Zur Zukunft der digitalen Infrastruktur
Für Diskussionen sorgt auch der von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton geplante Digital Networks Act (DNA) (öffnet in neuem Tab), der den Telekommunikationssektor in Europa neu strukturieren könnte. Gerade zwischen den großen Netzbetreibern und manchen Verbänden gibt es hier gegensätzliche Ansichten (öffnet in neuem Tab). In den nächsten Wochen, voraussichtlich Mitte Februar, sollen die Pläne für den DNA konkretisiert werden.
Debattiert wird zurzeit außerdem über den Gigabit Infrastructure Act (GIA) (öffnet in neuem Tab), der für einheitliche Bedingungen und sinkende Kosten beim Ausbau der Breitbandnetze sorgen soll. Aktuelle Forderungen (öffnet in neuem Tab) gibt es hier unter anderem dazu, den Überbau von Glasfaserinfrastruktur durch Konkurrenten unterbinden zu können. Das Trilog-Verfahren zum GIA beginnt Ende Januar.
Ob diese Vorhaben aus dem Bereich der digitalen Infrastruktur und – speziell der DNA – noch vor der Europawahl abschließend entschieden sein werden, ist eher zu bezweifeln. Bevor ein neues Parlament und dann auch eine neue EU-Kommission zusammentritt, wird an vielen Projekten aber sicherlich noch intensiv gearbeitet.
Wie es bei bestimmten Gesetzen vorangeht und vor allem welche digitalpolitischen Pläne die europäischen Parteifamilien in ihren Wahlprogrammen für die Zeit nach dem Urnengang haben, werden wir bald auch hier im Blog beleuchten.
Mehr Informationen:
Digitalpolitischer Jahresausblick: Was in Deutschland 2024 ansteht (öffnet in neuem Tab)
Standpunkt: Digitale Netze – Basis für eine klimaneutrale Zukunft! (öffnet in neuem Tab)
Europatag 2023: So weit sind die digitalpolitischen Vorhaben der EU (öffnet in neuem Tab)