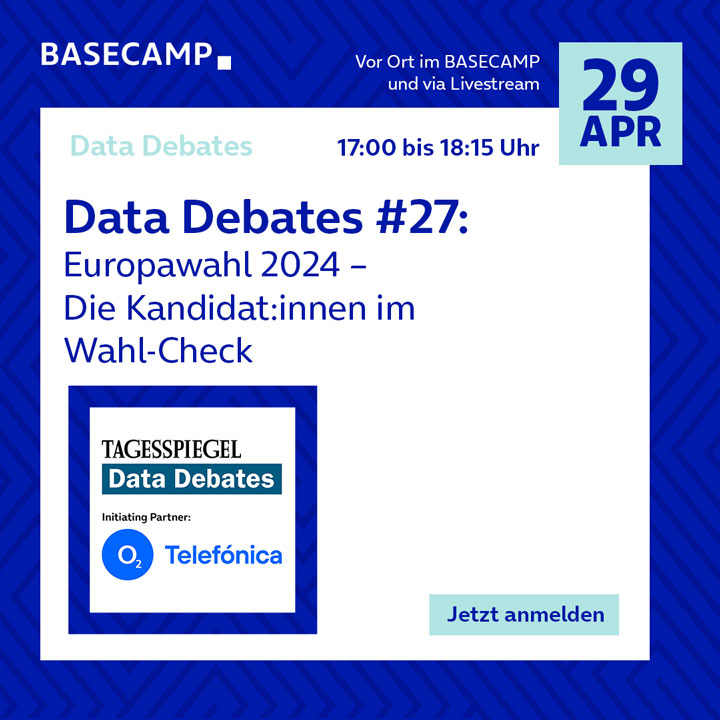Kampf gegen Desinformation: Ein Überblick über Projekte und Initiativen


Die zunehmende Verbreitung von Desinformation vor allem in diesem Superwahljahr zeigt deutlich, wie sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden und demokratische Prozesse destabilisieren kann, wenn ihr nicht entgegengewirkt wird. Dies ist auch für Europa und Deutschland relevant, gerade mit Blick auf die nächste Bundestagswahl in wenigen Monaten. Es gibt mittlerweile jedoch viele Projekte und Akteure aus verschiedenen Bereichen, die der Desinformation nicht das Feld überlassen möchten – einige davon stellen wir hier vor, um zu zeigen, was bereits unternommen wird.
Dass Desinformation, besonders im digitalen Raum, eine Gefahr (öffnet in neuem Tab) für die politische Kultur in Demokratien darstellt, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Ebenso, dass man nicht tatenlos zusehen darf, wie gezielte Falschinformationen Diskurse vergiften, Menschen gegeneinander aufwiegeln und die Unterscheidung zwischen Fakten und Fiktionen zunehmend erschweren.
Mehrere Ziele im Blick
Deshalb gibt es bereits heute eine große Bandbreite an Organisationen, Projekten und Initiativen, die meist eins oder mehrere der folgenden Ziele verfolgen: Sie möchten über die Methoden (öffnet in neuem Tab) der Desinformation aufklären und Menschen immun dagegen machen, etwa durch die Vermittlung von Medienkompetenzen. Oder sie analysieren einzelne Phänomene der Desinformationssphäre und entwickeln Empfehlungen an Politik und Gesellschaft für einen besseren Umgang mit Falschinformationen. Dabei stehen häufig auch die sozialen Medien und ihre Betreiber im Fokus, um die Verbreitung von Desinformation einzudämmen.

Auf staatlicher Seite verfolgt die Bundesregierung mehrere Schritte (öffnet in neuem Tab) im Kampf gegen Desinformation, wie die Beobachtung und Analyse, die zeitnahe Richtigstellung von Falschinformationen, der Aufbau von gesamtstaatlicher Resilienz und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Für letzteres gibt es zum Beispiel Formate für jüngere Menschen wie „Fake Train“ (öffnet in neuem Tab) von der Bundeszentrale für politische Bildung. Außerdem hat die Bundesregierung eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe gegen hybride Bedrohungen eingerichtet und fördert durch einzelne Ministerien auch viele zivilgesellschaftliche Projekte zum Thema.
Europaweite Vernetzung
Zudem unterstützt Deutschland die gemeinsamen Maßnahmen der EU gegen Desinformation, zum Beispiel die Internetseite EUvsDisinfo (öffnet in neuem Tab) des Europäischen Auswärtigen Dienstes, auf der speziell prorussische Desinformation analysiert und widerlegt wird. Mit dem European Digital Media Observatory (EDMO) (öffnet in neuem Tab) und der Alliance4Europe (öffnet in neuem Tab) fördert die EU außerdem länderübergreifende, multidisziplinäre Netzwerke und Projekte von Akteuren, die sich mit Online-Desinformation befassen – darunter Faktenchecker, Medienorganisationen oder akademische Forschung zum Thema.
Einen aktuellen Überblick über staatliche Anti-Desinformationsmaßnahmen aus allen Kontinenten, ihre Wirkungen und die Gefahr autoritären Missbrauchs bietet übrigens ein Bericht der Bertelsmann Stiftung (öffnet in neuem Tab), der auf die Notwendigkeit kombinierter und ganzheitlicher Online- und Offline-Maßnahmen gegen Desinformation hinweist.
Was Unternehmen bereits tun
Innerhalb Deutschlands hat darüber hinaus das Land Bayern im Vorfeld der diesjährigen Europawahlen die sogenannte Bayern-Allianz gegen Desinformation (öffnet in neuem Tab) ins Leben gerufen und darin bisher neun führende Tech-Unternehmen (u.a. Microsoft, IBM, Google, Meta), den Bayerischen Rundfunk und das Bayerische Forschungsinstitut für Digitale Transformation versammelt, um gemeinsam konkrete Maßnahmen und Best Practices gegen Desinformation zu entwickeln. Dazu gehören etwa professionelle Faktenchecks, Schulungsangebote für die eigenen Mitarbeitenden oder Content Credentials, die die Herkunft und Bearbeitung digitaler Inhalte transparent dokumentieren.
Die Fortschritte der Bayern-Allianz, der auch O2 Telefónica angehört, sowie das Engagement weiterer Unternehmen beleuchtet außerdem der Bitkom in einem Policy Brief (öffnet in neuem Tab), der aufzeigt, wie wirtschaftliche Akteure sich gegen Desinformation und Deepfakes einsetzen können. Darin wird unter anderem die Rolle der Unternehmen beleuchtet, die einerseits eine wichtige Schnittstellenfunktion bei der Moderation von Inhalten erfüllen und andererseits neue technische Lösungen, etwa bei der Deepfakebekämpfung durch die Bilder-Rückwärtssuche, entwickeln können.

Telefónica selbst bietet im Rahmen des Projekts „Digital mobil im Alter“ Materialen für Senioren, etwa Fit gegen Fake News (öffnet in neuem Tab) oder einem Quiz (öffnet in neuem Tab), und hat bereits vor Jahren das Projekt Wake UP! (öffnet in neuem Tab) gegen Cybermobbing, Desinformation und Hate Speech ins Leben gerufen, das für Schüler:innen, Eltern und Lehrkräfte umfassende Informationen und Hilfsangebote bereitstellt, zum Beispiel in Form von EDU-Stories (öffnet in neuem Tab) oder einem neuen TikTok-Kanal (öffnet in neuem Tab).
Für mehr Medien- und Nachrichtenkompetenz
Die Unterstützung der Beteiligten im Bildungsbereich steht auch bei anderen Projekten im Fokus, etwa bei weitklick (öffnet in neuem Tab), einem bundesweiten medienpädagogischem Bildungsprogramm gegen Desinformation. Diverse Medien und Bildungsorganisationen haben sich zudem im bundesweiten Bündnis Journalismus macht Schule (öffnet in neuem Tab) zusammengeschlossen, das mit Unterrichtsmaterialien und Journalist:innenbesuchen in Klassen zu mehr Informations- und Nachrichtenkompetenz beitragen möchte.
Auf medialer Seite gibt es darüber hinaus die Initiative für Medienkompetenz #UseTheNews (öffnet in neuem Tab), die mit dem Jahr der Nachricht 2024 (öffnet in neuem Tab) für faktentreue Nachrichten und mehr gesellschaftlichen Resilienz gegen Desinformation wirbt. Eine ähnliche Zielstellung verfolgt unter anderem der Podcast Fit for news (öffnet in neuem Tab) von detektor.fm, der den Hörer:innen verständliche Antworten und Hilfestellung geben möchte, um die eigene Informations- und Medienkompetenz zu stärken.
Faktenchecks und digitale Tools als Antwort der Zivilgesellschaft
Ebenfalls im medialen Bereich ist außerdem Correctiv (öffnet in neuem Tab) angesiedelt, das als gemeinwohlorientiertes Medienunternehmen investigative Recherchen betreibt, Bildungsprogramme anbietet und gegen Desinformation insbesondere Faktenchecks bereitstellt. Correctiv ist zudem Teil des bereits erwähnten europaweiten Netzwerks EDMO.
Factchecking und eine gut informierte Gesellschaft haben sich aber auch andere zivilgesellschaftliche Akteure auf die Fahnen geschrieben. Zum Beispiel codetekt (öffnet in neuem Tab), das seinen Trust-Checking-Ansatz an Schulen, außerschulischen Einrichtungen und in Unternehmen vermittelt oder Projekte wie faktenstark (öffnet in neuem Tab) realisiert.
Speziell auf Social-Media-Plattformen ist das Selbstlerntool SwipeAway (öffnet in neuem Tab) ausgerichtet, das vom Projekt re:set (öffnet in neuem Tab) der Amadeo-Antonio-Stiftung Sachsen entwickelt wurde, um menschenfeindliche Erzählungen in den sozialen Medien zu erkennen. Anhand eigens entwickelter, KI-generierter Beispiele werden bestimmte aktuelle Phänomene beleuchtet und Strategien dahinter enttarnt, damit Pädagog:innen, dadurch mit Jugendlichen ins Gespräch kommen können.
Die Politik als Adressat
Der Gewalt im digitalen Raum widmet sich ganzheitlich hingegen HateAid (öffnet in neuem Tab), das als gemeinnützige Organisation zum einen Beratung und rechtliche Unterstützung für Betroffene bietet, zum anderen aber auch Politik und Gesellschaft für das Problem digitaler Gewalt sensibilisieren und Veränderungen, etwa in der Gesetzgebung, bewirken möchte.
Eine breite öffentliche Debatte und Empfehlungen an die Politik hat ebenso das Forum gegen Fakes (öffnet in neuem Tab) zum Ziel – allerdings zum Thema Desinformation. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit dem Bundesinnenministerium, bei dem ein zufällig ausgewählter Bürgerrat über den richtigen Umgang mit Desinformation debattiert hat. Die Ergebnisse, 15 Empfehlungen und 28 konkrete Maßnahmen, wurden in Form eines Bürgergutachtens (öffnet in neuem Tab) Mitte September dem BMI übergeben. Das Gutachten soll nun für die Erarbeitung einer Strategie der Bundesregierung zum Umgang mit Desinformation genutzt werden.
Vielfältige Forschung
Für dieses Vorhaben kann die Politik mittlerweile auch auf die Forschungsergebnisse verschiedener Akteure zurückgreifen, die unterschiedliche Aspekte des Themas Desinformation in ihren Analysen untersuchen. Dazu gehören zum Beispiel das Institute for Strategic Dialogue (ISD) (öffnet in neuem Tab), CeMAS (öffnet in neuem Tab), das EU DisinfoLab (öffnet in neuem Tab) oder polisphere (öffnet in neuem Tab). Zudem gibt es eine vielfältige universitär angebundene Forschung, etwa das Forschungsbündnis „news-polygraph“ (öffnet in neuem Tab), das Künstliche Intelligenz zur Erkennung manipulierter Medieninhalte nutzt. Das gleiche Ziel verfolgt auch das EU-geförderte Projekt vera.ai (öffnet in neuem Tab), das KI-gestützte Tools gegen Desinformation entwickeln möchte.
Diese vielfältige Auswahl an Projekten und Initiativen zeigt, dass die gesellschaftliche Relevanz des Themas Desinformation bei vielen Akteuren bereits erkannt worden ist. Sie werden gegenüber den künftigen Veränderungen gezielter Falschinformation sicherlich wachsam sein und die Augen offenhalten – was aber auch gesamtgesellschaftlich nötig ist, um mehr Resilienz gegenüber dieser fortwährenden Herausforderung aufzubauen. Gerade über die kommende Bundestagswahl hinaus.
Event-Ankündigung:
Am 13. November 2024 setzen sich beim Generationendialog von WAKE UP! Schulklassen und Senior:innen (öffnet in neuem Tab) mit Desinformation im politischen Kontext auseinander und diskutieren mit Expert:innen wie Alexander Sängerlaub kommunikative Strategien zur Verbreitung solcher Botschaften.
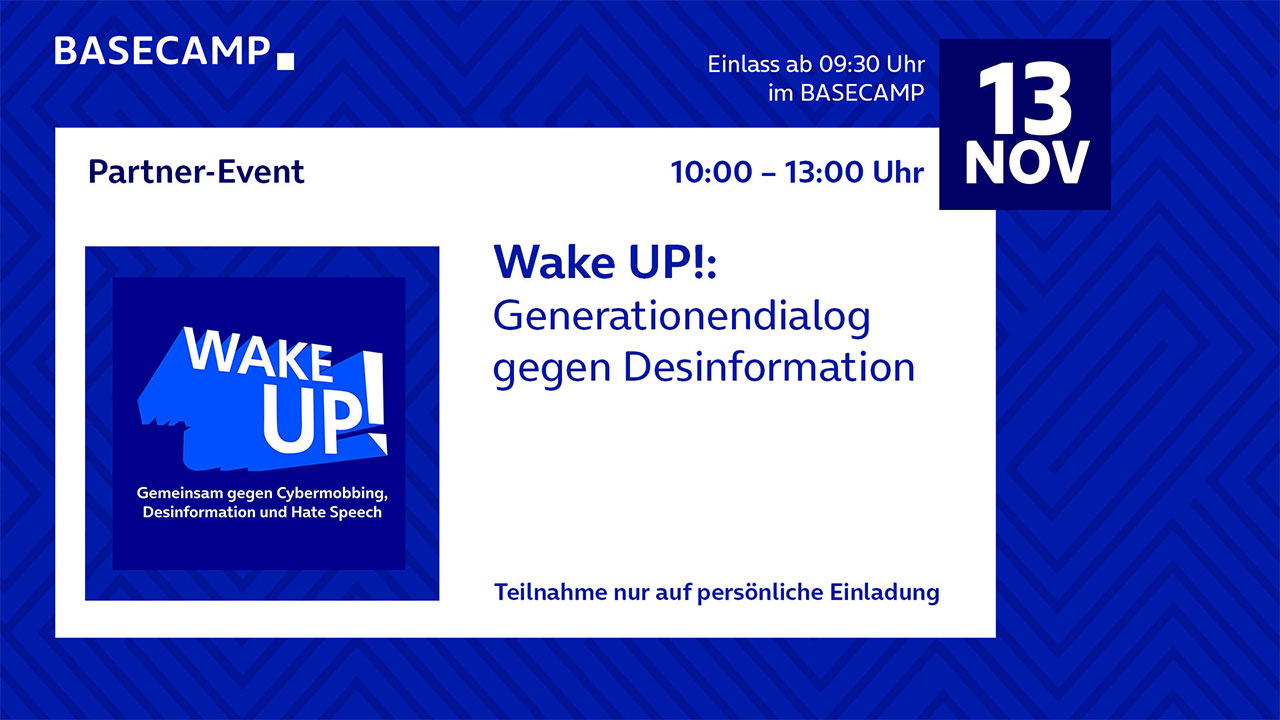
Mehr Informationen:
Digitale Desinformation: Welche Methoden man kennen sollte (öffnet in neuem Tab)
Digitale Desinformation: Eine Herausforderung für Wahlen und Demokratie (öffnet in neuem Tab)
Olympische Spiele 2024: Wie Online-Desinformation verbreitet wird (öffnet in neuem Tab)