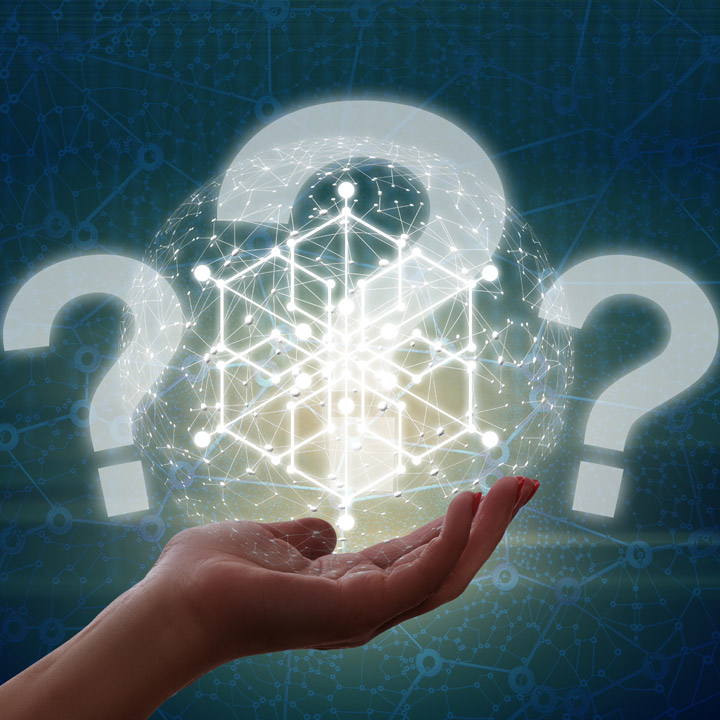Fake News: Gegen Desinformationen in der Corona-Krise
Foto: CC0 1.0, Pixabay User geralt | Ausschnitt angepasst
Wächst die Unsicherheit, wächst das Bedürfnis der Menschen nach Informationen. Umso wichtiger ist, dass diese Informationen gesichert sind. Falschinformationen wie bewusst verbreitete Desinformationen zum Corona-Virus oder den Maßnahmen zu dessen Eindämmung können dagegen die Unsicherheit befeuern oder gar Panik schüren. EU-Kommission und Bundesregierung haben daher Maßnahmen gegen Fake News ergriffen.
Dank sozialer Medien und Instant-Messaging-Dienste lassen sich Nachrichten und Informationen in der digitalen Welt schnell und einfach teilen. Seriöse Information sind vor allem in der Corona-Krise von essenzieller Bedeutung, jedoch verbreiten sich derzeit viele Falschmeldungen, die Ängste befeuern und Menschen auch potenziell gefährden. Angefangen bei fragwürdigen Gesundheitstipps wie dem Trinken von Bleichmittel, um gegen das neuartige Coronavirus immun zu sein, bis hin zu kruden Verschwörungen, die behaupten, dass SARS-CoV-2 nicht existiere und beispielsweise der neue Mobilfunkstandard 5G der Auslöser der Krankheit Covid-19 sei.
In der Politik wächst die Sorge über die Auswirkungen derartiger Desinformation, die sich in sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer ausbreitet. Neben dem Kampf gegen das Virus, gewinnt daher auch der Kampf gegen Fake News an Bedeutung. Wir zeigen euch, welche Maßnahmen die Europäische Union und die Bundesregierung ergreifen und wie ihr selbst Falschinformationen erkennen könnt.
Zusammenarbeit zwischen EU und Online-Plattformen
Alle wichtigen Informationen zum Krisenmanagement der EU und rund um das Virus finden sich zentral (öffnet in neuem Tab) auf der Webseite der Europäische Kommission (öffnet in neuem Tab). Seit Neuestem existiert auch eine gesonderte Rubrik, die Falschmeldungen zu Corona (öffnet in neuem Tab) richtigstellt und Faktenchecks zu den gängigsten Mythen bündelt – so auch ein Faktencheck zur 5G-Theorie (öffnet in neuem Tab). Darüber hinaus mahnt die EU-Kommission, bei Gesundheitsfragen nur „vertrauenswürdigen Stellen wie nationalen Gesundheitsbehörden, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC)“ zu vertrauen. Vor allem Informationen zu Heilmitteln oder Gesundheitstipps aus sozialen Medien sollten stets kritisch beurteilt werden – dabei kann vor allem der Corona-Faktencheck (öffnet in neuem Tab) der WHO helfen.

Zur Bekämpfung von Desinformation im Netz arbeitet die EU auch intensiv mit den großen sozialen Plattformen zusammen: „Wir halten sie dazu an, verlässliche Quellen zu fördern, erkanntermaßen falschen oder irreführenden Inhalten kein Forum zu bieten und illegale oder potenziell schädliche Inhalte zu entfernen“, heißt (öffnet in neuem Tab) es dazu aufseiten der EU-Kommission. Grundlage dafür bildet der Verhaltenskodex (öffnet in neuem Tab) zur Bekämpfung von Desinformation im Internet, auf den sich Online-Plattformen sowie soziale Netzwerke und die Werbeindustrie im September 2018 auf Initiative der Kommission verständigten. Věra Jourová (öffnet in neuem Tab), Vizepräsidentin der EU-Kommission und Kommissarin für Werte und Transparenz, forderte (öffnet in neuem Tab) jüngst weitere Schritte: Unternehmen wie Google, Facebook, Twitter, Microsoft und Weitere sollen relevante Daten mit Forscher*innen und Faktenprüfern teilen und mit den Behörden in allen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um gefährliche Gerüchte frühzeitig erkennen und aufklären zu können.
In diese Richtung weist bereits eine aktuelle Facebook-Initiative: Der Social Media-Riese beabsichtigt, eine neue Funktion namens „Correct the Record“ einzuführen, die Nutzer*innen darauf hinweisen soll, wenn sie potenziell schädliche Falschmeldungen rundum COVID-19 zur Kenntnis genommen haben. „Wir zeigen im News Feed denjenigen Nutzern, die auf COVID-19-bezogene Beiträge reagiert haben […], neue Informationen an, sofern wir den ursprünglichen Beitrag mittlerweile als schädliche Fehlinformation eingestuft und entfernt haben“, heißt es dazu in einer aktuellen Mitteilung (öffnet in neuem Tab). In diesem Zusammenhang sollen Nutzer*innen auf Klarstellungen und Fakten vertrauenswürdiger Quellen wie der WHO hingewiesen werden.
Informationsangebote der Bundesregierung
Auch die Bundesregierung reagiert auf das Informationsbedürfnis der Bevölkerung – beispielsweise mit dem neuen Podcast „Corona aktuell (öffnet in neuem Tab)„. In der aktuellen, fünften Folge spricht der Leiter der Strategischen Kommunikation im Europäischen Auswärtigen Dienst Lutz Güllner (öffnet in neuem Tab) über die Strukturen und Akteure hinter systematischen Desinformationskampagnen. Deren Ziel ist unter anderem, das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie und deren Glaubwürdigkeit zu schwächen. Sei es durch Falschmeldungen zum Krisenmanagement, dass als unzureichend dargestellt wird oder durch die Erzählung kruder Verschwörungstheorien. Gegen solch gezielte Desinformation helfe beispielsweise offene und transparente Kommunikation, so Güllner.

Vorreiter ist hierbei das Bundesministerium für Gesundheit (öffnet in neuem Tab) (BMG): Sei es Twitter (öffnet in neuem Tab), Facebook (öffnet in neuem Tab), LinkedIn (öffnet in neuem Tab) oder TikTok (öffnet in neuem Tab) – das BMG ist in so gut wie allen sozialen Medien vertreten. Dort informieren die Mitarbeit*innen des Ministeriums kontinuierlich und verständlich über die ergriffenen Maßnahmen sowie die Sachlage und beantworten außerdem Fragen einzelner Nutzer*innen. Zusätzlich betreibt das BMG die Informationsplattform Zusammen gegen Corona (öffnet in neuem Tab). Diese bietet ebenfalls verlässliche und gesicherte Informationen rund um die Corona-Krise, dient aber gleichzeitig als Plattform, um hilfsbedürftige Menschen mit ehrenamtlichen Helfer*innen zusammenzubringen.
Falschmeldungen erkennen
Wie kann man aber selbst sicherstellen, keiner falschen Information auf den Leim zu gehen? Grundsätzlich sollte man Quellen stets prüfen und gucken, ob die Information, die man erhalten hat, auch auf den offiziellen Portalen von Bund und Ländern (öffnet in neuem Tab), der Seite des Robert-Koch-Instituts (öffnet in neuem Tab) oder bei seriösen Medien wie dem öffentlich-rechtliche Rundfunk zu finden sind, rät die Bundesregierung.
In Bezug auf Soziale Medien wird empfohlen (öffnet in neuem Tab): „Halten Sie sich in den sozialen Netzwerken an verifizierte Accounts, die am blauen Haken erkennbar sind, und sehen Sie sich das Impressum einer Website an.“ Zwar werden Falschmeldungen häufig aus Sorge und nicht böswillig verbreitet, jedoch führe dies oft zu Verunsicherung und Panik anstatt zum eigentlichen Ziel – der Information. „Umso wichtiger ist es, sich daran nicht zu beteiligen und Ruhe zu bewahren. Besser löschen, als weiterverbreiten“, laute hier die Devise.