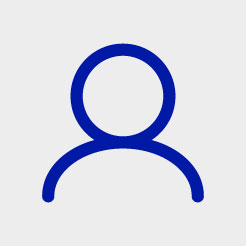EU-Recht: EuGH lässt Vorratsdaten-speicherung in Ausnahmefällen zu


Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. | Foto: CC0 1.0 | Pixabay User LVER | Ausschnitt angepasst
Die Speicherung von persönlichen Verbindungsdaten zu Telefongesprächen ist ein heikles Thema. Der Europäische Gerichtshof hat den Sicherheitsbehörden für die Vorratsdatenspeicherung mit seinen aktuellen Urteilen hohe Hürden auferlegt, was bisher jedoch noch nicht für Deutschland gilt. Politik und Verbände diskutieren aber schon mögliche Folgen.
Der Europäische Gerichtshof (öffnet in neuem Tab) (EuGH) bleibt grundsätzlich bei einem pauschalen Verbot der Vorratsdatenspeicherung. Die Luxemburger Richter haben jedoch mit ihren Urteilen (öffnet in neuem Tab) vom Dienstag Ausnahmen definiert, in denen das Sammeln persönlicher Telefon- und Internetdaten erlaubt sein soll. Wenn in einem EU-Mitgliedstaat ein konkreter Fall einer Bedrohung der nationalen Sicherheit oder schwere Kriminalität vorliegt, ist eine zeitlich begrenzte, begründete Vorratsdatenspeicherung zulässig. Wenn beispielsweise ein konkreter Terrorverdacht vorliegt, dürfen nach Prüfung durch ein Gericht, Echtzeit-Daten ausgewertet werden – aber nur so lange wie es unbedingt erforderlich ist. Außerdem dürfen die Behörden von den Internetprovidern auch die Herausgabe von IP-Adressen verlangen.
Die Urteile erklären formal nur die Vorratsdatenspeicherung in Großbritannien, Frankreich und Belgien für unvereinbar mit EU-Recht. Wegen ihres grundsätzlichen Charakters könnten sich die Entscheidungen aber auch auf Deutschland auswirken. In der Bundesrepublik hatte die Bundesnetzagentur (öffnet in neuem Tab) 2017 den Speicherzwang für Internet-Provider und Telefonanbieter wegen Bedenken um die Vereinbarkeit mit EU-Recht vorläufig ausgesetzt. Die Vorratsdatenspeicherung ist seit langem ein Streitthema zwischen Verbraucher- und Datenschützern auf der Contra- sowie den Sicherheitsbehörden auf der Pro-Seite.
Politische Reaktionen
Aus der Opposition – von FDP, Linken und Grünen – kommt Lob für die Urteile. Das Gericht habe erklärt, dass eine flächendeckende und pauschale Vorratsdatenspeicherung unvereinbar mit den Grundrechten sei, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae (öffnet in neuem Tab). „Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ist damit nicht zu halten“, betonte (öffnet in neuem Tab) er, die Union müsse von ihrer Forderung danach abrücken. Die netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Anke Domscheit-Berg (öffnet in neuem Tab), ruft (öffnet in neuem Tab) die Bundesregierung dazu auf, endlich „den Zombie Vorratsdatenspeicherung zu beerdigen“. Außerdem sollten alle bestehenden Überwachungsgesetze auf den Prüfstein.

Für die Grünen ist die Vorratsdatenspeicherung nach den Urteilen „mausetot“. „Wir wissen seit Jahren, dass die Massendatenspeicherung kein Mehr an Sicherheit bringt. Vielmehr frisst sie knappe Ressourcen und verstellt den Blick auf tatsächlich zielführende Ermittlungsansätze“, sagten (öffnet in neuem Tab) der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz (öffnet in neuem Tab) und die netzpolitische Sprecherin Tabea Rößner (öffnet in neuem Tab).
Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (öffnet in neuem Tab) fordert (öffnet in neuem Tab), die EuGH-Urteile als „Grenze für zukünftige Gesetze zu sehen“. Es sei nicht nachvollziehbar, dass ein Jahr vor der Bundestagswahl im Schnellverfahren anstehende Gesetze im Bereich Telekommunikation geplant seien, die der Linie des EuGH widersprechen. Während der EU-Ratspräsidentschaft sollte sich Deutschland vielmehr dafür einsetzen, dass keine neuen Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung entstehen, besonders bei der E-Privacy-Verordnung, die die Privatsphäre bei der elektronischen Kommunikation schützen soll. Mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr sollten die Parteien außerdem die EuGH-Urteile in ihren Wahlprogrammen berücksichtigen, empfiehlt Kelber.
Thorsten Frei (öffnet in neuem Tab), stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ist hingegen enttäuscht von den Urteilen. Sie blieben „hinter den Hoffnungen zurück“, sagte (öffnet in neuem Tab) er. „Ich hoffe, dass der Gerichtshof sich bei Betrachtung der deutschen Regelung hier weiter öffnet.“ Das Gericht lasse zwar „eine erste vorsichtige Abkehr von seiner extrem datenschutzfreundlichen Linie erkennen“, allerdings halte es bei schweren Verbrechen im Netz nur an der begrenzten Datenspeicherung fest. Sobald das Urteil vollständig vorliege, soll geprüft werden, welche Möglichkeiten Ermittler bekommen können. Frei ist nach wie vor von den Vorteilen der Vorratsdatenspeicherung überzeugt. Sie sei „das mit Abstand wirksamste Mittel“, damit Polizei und Staatsanwaltschaft gegen „Kinderschänder und organisierte Kriminalität im Netz“ vorgehen könne.
Das sagen Digitalverbände zu den Urteilen
Der Verband der Internetwirtschaft (eco (öffnet in neuem Tab)) begrüßt die Urteile. Der EuGH sei seiner bisherigen Linie damit treu geblieben und habe konsistent entschieden. „Die EuGH-Urteile stärken die Grundrechte in Europa und stellen eine deutliche Mahnung an die nationalen Gesetzgeber in den EU-Mitgliedstaaten dar, die ihre bisherigen Regelungen jetzt kritisch hinterfragen sollten“, sagte (öffnet in neuem Tab) eco-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme (öffnet in neuem Tab).
Der Verein Digitale Gesellschaft (öffnet in neuem Tab) sieht seine Warnungen bestätigt. Gemeinsam mit anderen Organisationen wendet er sich mit einem Offenen Brief (öffnet in neuem Tab) an die EU-Kommission und fordert ein EU-weites Verbot „von anlassloser Telekommunikations-Überwachung“. Henning Tillmann (öffnet in neuem Tab), Co-Vorsitzender von D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt – hofft (öffnet in neuem Tab), dass nun die verschiedenen anhängigen Verfahren bezüglich der deutschen Vorratsdatenspeicherung, sowohl vor dem EuGH als auch am Bundesverfassungsgericht, wieder in Bewegung kommen. Es bleibe jedoch fraglich, ob innenpolitische Vertreterinnern und Vertreter „endlich die richtigen Schlüsse ziehen und neue Instrumente zur Bekämpfung von Kriminalität finden und nutzen“.
Tagesspiegel Politikmonitoring
Der vorstehende Artikel erscheint im Rahmen einer Kooperation mit dem Tagesspiegel Politikmonitoring (öffnet in neuem Tab) auf der Website des BASECAMP.