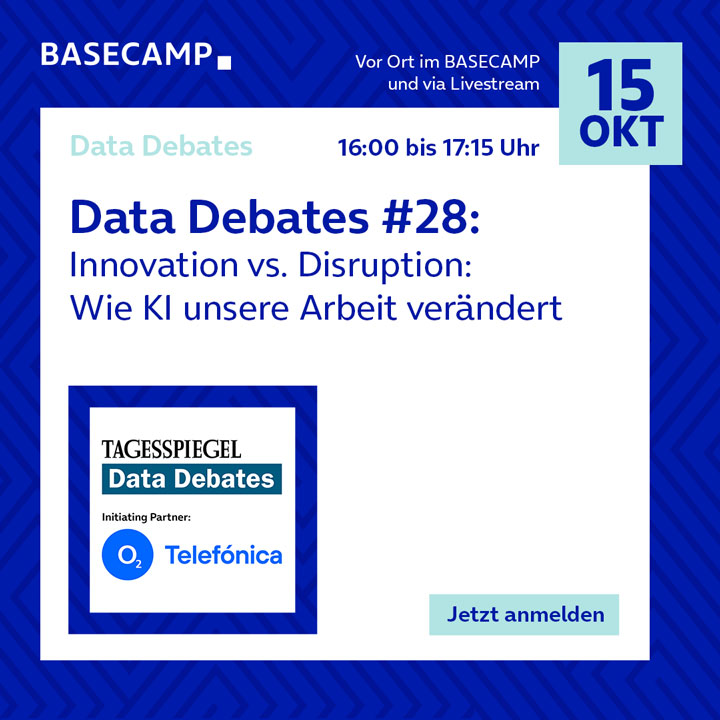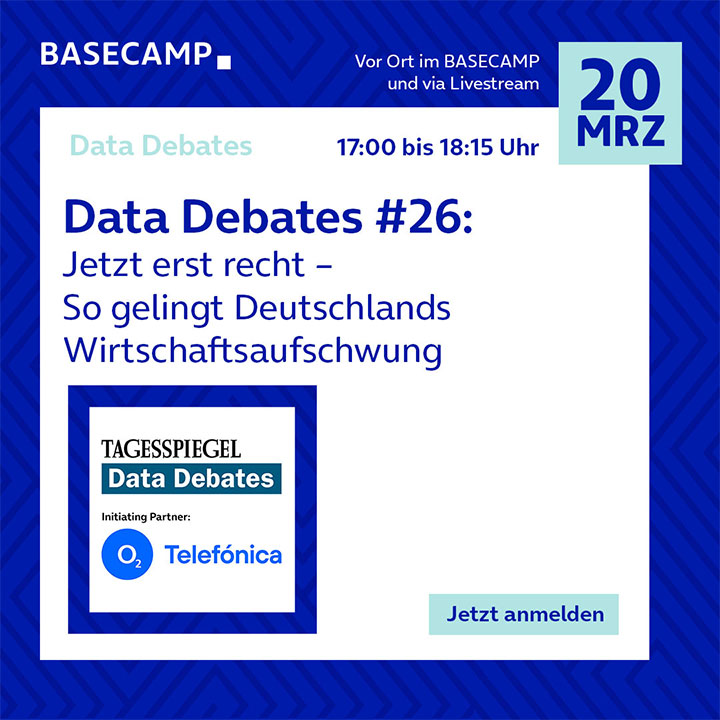Industriestrategie: Neue Regeln für die Digitalisierung
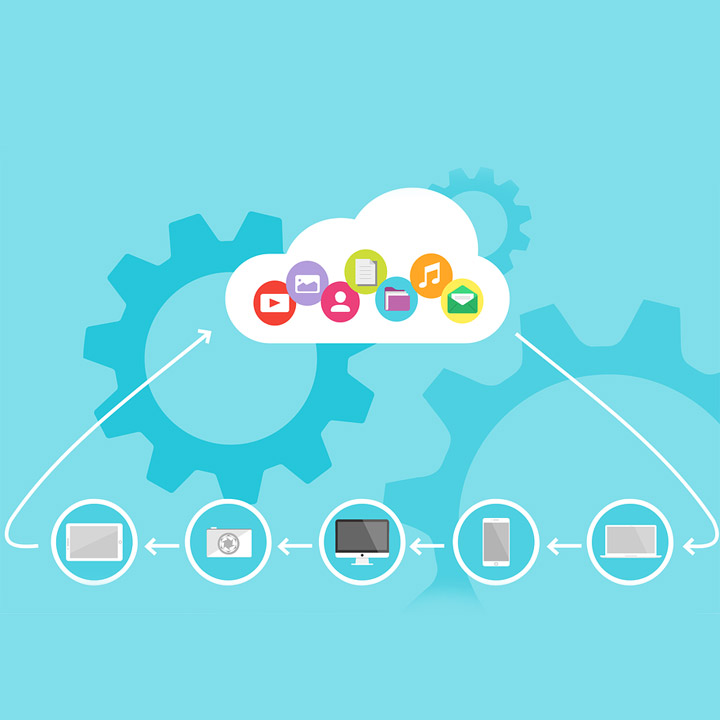
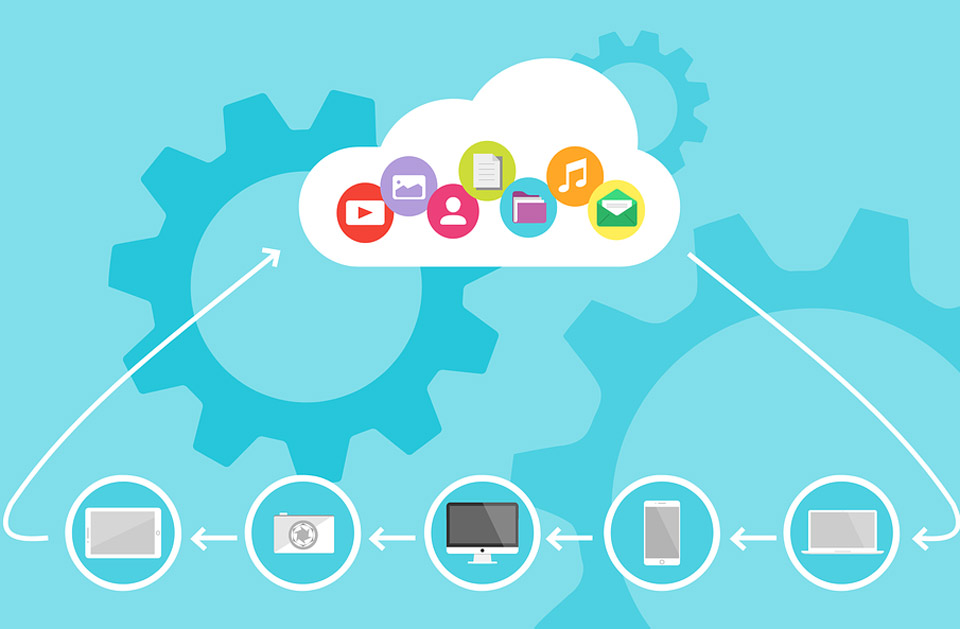
Am 21. und 22. März (öffnet in neuem Tab) traf sich der Europäische Rat (öffnet in neuem Tab) in Brüssel um auf eine Initiative Deutschlands und Frankreichs hin die europäische Industriepolitik zu erörtern. In Zuge dessen wurde die Europäische Kommission (öffnet in neuem Tab) beauftragt, bis Ende 2019 eine Industriestrategie mit konkreten Maßnahmen vorzulegen. Kerninhalte sollen u.a. Handelsfragen, der Umgang mit technologischen Umbrüchen, die Verankerung neuer, datenbasierter Geschäftsmodelle, aber auch Klimaschutz und die Reduktion von CO2-Emissionen sein.

Der Europäische Rat hat daher die Mitgliedstaaten aufgerufen (öffnet in neuem Tab), den Binnenmarkt zu stärken, den Freihandel zu stärken und die wettbewerbsfähige, industrielle Basis Europas auszubauen. Dabei spielt die Digitalisierung eine zentrale Rolle: Der Europäische Rat dringt vor allem darauf, die digitale Wirtschaft weiterzuentwickeln und die Investitionen und Risikobereitschaft im Forschungs- und Innovationsbereich zu erhöhen.
Altmaiers Ideen für eine deutsche Strategie
Anfang Februar hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (öffnet in neuem Tab) (CDU) bereits den Entwurf einer Nationalen Industriestrategie 2030 (öffnet in neuem Tab) vorgestellt, der strategische Leitlinien für eine deutsche und europäische Industriepolitik formuliert. Der Entwurf soll als Diskussionsgrundlage für Akteuren aus Wissenschaft, Industrie und Politik dienen. Im Anschluss daran soll die Strategie in der Bundesregierung (öffnet in neuem Tab) abgestimmt und beschlossen werden.
Kernziel der Strategie ist die „Sicherung und Wiedererlangung von wirtschaftlicher und technologischer Kompetenz, Wettbewerbsfähigkeit und Industrie-Führerschaft auf nationaler, europäischer und globaler Ebene.“ Die Nationale Industriestrategie 2030 soll zudem definieren, wann ein staatliches Eingreifen gerechtfertigt ist, um Nachteile für die eigene Volkswirtschaft zu verhindern.
Handlungsbedarf (öffnet in neuem Tab) identifiziert das Bundeswirtschaftsministerium (öffnet in neuem Tab) (BMWi) im Entwurf vor allem im Bereich von Schlüsseltechnologien wie der Digitalisierung, der Künstlichen Intelligenz und der Batteriezellenfertigung. Vor diesem Hintergrund plädiert das BMWi für eine Stärkung des Mittelstandes und verbesserte, wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Wie der Europäische Rat, sprach sich das BMWi in seinem vorhergehenden Entwurf für die Mobilisierung von mehr Wagniskapital und die Förderung und den Erhalt der technologischen Souveränität Europas aus – die EU soll also bei den Zukunftstechnologien mitspielen können. Vor allem solle das Beihilfe- und Wettbewerbsrecht (öffnet in neuem Tab) überprüft werden, damit neue Geschäftsmodelle und Plattformen wie Google, Amazon und Alibaba auch in Europa entstehen können und der Entwicklung der Plattformökonomie keine Steine in den Weg gelegt werden.
Seit der Veröffentlichung des Entwurfs der Nationalen Industriestrategie 2030, traf sich der Bundeswirtschaftsminister mit der EU-Kommissarin für Wettbewerb Margarethe Vestager (öffnet in neuem Tab) und mehreren seiner europäischen Amtskollegen (öffnet in neuem Tab), um über seine Vorschläge für die Stärkung der europäischen Industrie zu sprechen. Mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire hatte Altmaier (öffnet in neuem Tab) Mitte Februar zudem ein „deutsch-französisches Manifest (öffnet in neuem Tab) für eine europäische Industriepolitik“ vorgestellt. Dieses sieht – wie schon der deutsche Entwurf – die Anpassung des Regulierungsrahmens vor, um europäische Unternehmen international wettbewerbsfähiger zu machen.
Im Bereich der neuen Technologien werden vor allem fünf Ziele ins Zentrum einer koordinierten Industriepolitik gestellt: Die Schaffung einer europäischen Strategie für die Technologiefinanzierung unter Einbeziehung von EU-Institutionen (wie des Europäischen Investitionsfonds – EIF), die Unterstützung risikoreicher Deep-Tech-Projekte auf europäischer Ebene, die mit einer großen Autonomie ausgestattet werden sollen, sowie Vorreiterrolle im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Als weitere Ziele werden die Förderung und Produktion hochmoderner Technologien in Europa genannt – von der Forschung bis zum ersten industriellen Einsatz. Zudem soll sichergestellt werden, dass die Europäischen Finanzmärkte Innovationen in der Industrie unterstützen, damit sich entsprechende Unternehmen leichter finanzieren können.
In Bezug auf das deutsch-französische Manifest erklärte Peter Altmaier:
„Minister Le Maire und ich haben heute gemeinsam ein Manifest für die Industriepolitik beschlossen. Denn wir brauchen eine europäische Industriestrategie, damit wir unsere Industrie für den harten globalen Wettbewerb zukunftsfähig machen können – das wird eine wichtige Aufgabe für die Kommission nach der Europawahl sein.“
EU Kommission veröffentlicht Studie zu Industriestrategie
Das European Political Strategy Centre (öffnet in neuem Tab) – der Think Tank der Europäischen Kommission – war ebenfalls nicht untätig und hat sich jüngst in einer Studie (öffnet in neuem Tab) mit der europäischen Industriepolitik befasst. Die Autoren der Studie begrüßen die verstärkte Debatte darüber, wie sich Europa im digitalen Zeitalter wirtschaftlich behaupten kann. Vor diesem Hintergrund entwickeln sie Vorschläge für die Gestaltung des internationalen Handels und die Rolle Europas. Die Autoren legen dar, wie die Europäer die industrielle Basis auf Grundlage von Innovation und neuen Technologien stärken können.
Zum Schutz der heimischen Industrie wird die bessere Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen in kritische Infrastruktur angeregt. Um die europäische Wettbewerbsfähigkeit weiter zu erhöhen und nicht hinter einheitlichen Märkten wie dem der USA oder China zurück zu fallen, sprechen sich die Autoren der Studie für eine Stärkung des Digitalen Binnenmarktes und eine stärkere europäische Koordinierung aus. Ferner identifizieren sie die Notwendigkeit für mehr Innovationen und Investments in zukunftsweisende Bereiche. Für das Ziel einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit plädieren die Studienautoren für eine gesteigerte, temporäre Zusammenarbeit zwischen europäischen Unternehmen, die sich gegenseitig ergänzen und somit ein umfassenderes Produktportfolio bieten können. Letztendlich soll Europa ein Vorkämpfer für Freihandel und Investitionen in der Welt bleiben, zugleich aber entschlossener die Versuche zurückdrängen, seinen guten Willen auszunutzen.