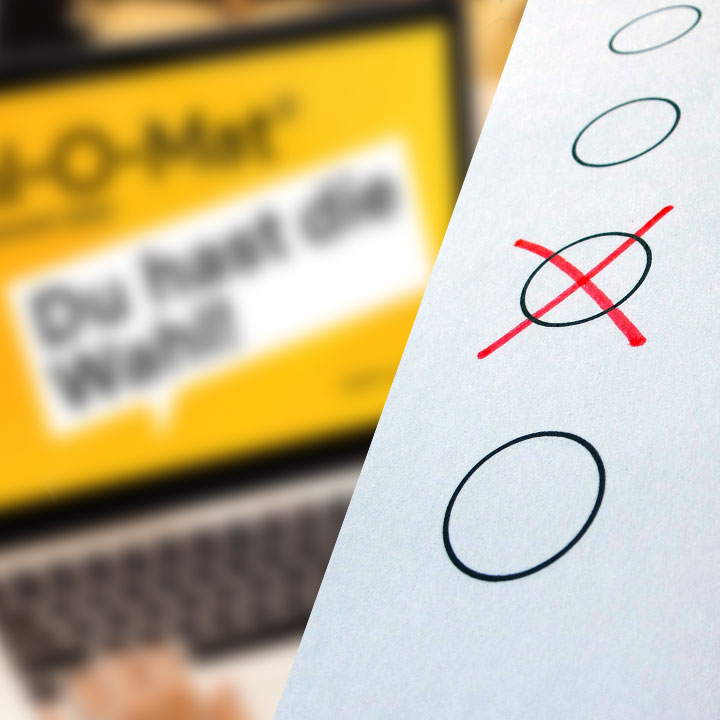Digitalisierung und Demokratie: Interview mit Joschua Helmer (WZB)


Die Digitalisierung verändert nicht nur unseren Alltag, sondern wirkt sich durch neue Möglichkeiten der Information, Kommunikation und Partizipation auch auf unsere demokratische Öffentlichkeit und politische Meinungsbildung aus. Mit Joschua Helmer vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) haben wir über das Spannungsfeld gesprochen, das digitale Technologien und Plattformen für die moderne Demokratie erzeugen.
Herr Helmer, die Digitalisierung beeinflusst fast alle Lebensbereiche. Vor welche Herausforderungen stellt sie die Demokratie?
Zunächst einmal sollte man meiner Meinung nach festhalten, dass der digitale Zugang zu Wissen und die Möglichkeit, sich über soziale Medien an politischen und gesellschaftlichen Debatten zu beteiligen, nach wie vor einen riesigen Emanzipationsgewinn darstellen. Diese Möglichkeiten wurden zeitweise – z.B. während des Arabischen Frühlings vor zehn Jahren – überschätzt, aber gerieten in den Krisendiagnosen der letzten Jahre manchmal etwas zu sehr aus dem Blick. Mein Eindruck ist allerdings, dass die Debatte um Digitalisierung und Demokratie nach und nach diesen „Krisenmodus“ verlässt und differenzierter wird.
Die grundlegendste Veränderung ist vermutlich die digitale Transformation der demokratischen Öffentlichkeit durch soziale Medien. Daneben spielen individuelle Autonomiegewinne und -verluste für die Bürger:innen eine wichtige Rolle: Ich kann das Internet nutzen, um mich umfassend zu informieren, aber werde gleichzeitig durch meine Datenspuren „lesbar“ und bin gezielten Manipulationsversuchen ausgesetzt. An Politiker:innen und Behörden wiederum stellt die Digitalisierung ganz neue Kompetenzanforderungen: Sie müssen neue Akteure und Technologien verstehen und ggf. regulieren, ohne dass dafür eine Blaupause besteht.
Und auch normativ wird die Demokratie herausgefordert, etwa mit dem Zukunftsversprechen einer überwiegend datenbasierten Politikentwicklung. Wenn Daten die Qualität politischer Entscheidungen erhöhen, ist das natürlich begrüßenswert, aber eine Datenspende – beispielsweise die Bereitstellung von individuellen Bewegungsdaten für Mobilitätspolitik – ist als weitgehend passiver Prozess ohne Interaktion oder Willensbildung etwas ganz anderes als ein Beteiligungsverfahren. Diese Vision einer „digitalen Demokratie“, in der Politik an scheinbar objektiv messbaren Bedürfnissen und Präferenzen ausgerichtet wird, halte ich für zutiefst undemokratisch. Gleichzeitig konfrontiert sie uns jedoch mit den Unzulänglichkeiten und Verzerrungen unserer aktuellen demokratischen Verfahren.
Welche Rolle spielen die großen Internet-Plattformen in diesem Wandel und wie sollte mit ihnen umgegangen werden?
Unter den Plattformen sind vor allem soziale Netzwerke direkt demokratierelevant: Sie sind neben Presse und Rundfunk mittlerweile eine zentrale Infrastruktur der demokratischen Öffentlichkeit, d.h. auf ihnen findet ein nennenswerter Bestandteil der politischen Debatten statt. Die klassischen Massenmedien bleiben dabei nach wie vor äußerst relevant, aber auch sie verbreiten ihre Inhalte über soziale Netzwerke.
Wir haben also ein hybrides, verschränktes Mediensystem, in dem verschiedene Kuratierungslogiken für politische Inhalte ineinandergreifen: Etwas verkürzt gesagt sind das die streng journalistischen Auswahlkriterien der Qualitätsmedien, die Kriterien des Boulevards, und personalisierte Inhalte und Empfehlungen in sozialen Medien.
Mit dem Medienstaatsvertrag gibt es jetzt erstmals ein umfassendes Konzept für die Regulierung dieses hybriden Mediensystems. Soziale Netzwerke sind als vergleichsweise neue Akteure allerdings nicht ohne Weiteres in den ‚klassischen‘ Regulierungsformen greifbar. Hier besteht meiner Meinung nach auf jeden Fall weiterer Regulierungsbedarf: Soziale Netzwerke verdienen ihr Geld damit, die Aufmerksamkeit von Nutzer:innen möglichst lange zu binden, und nicht etwa damit, möglichst produktive demokratische Debatten zu ermöglichen. Damit werden sie ihrer Bedeutung für den demokratischen Diskurs nicht von alleine gerecht. Gleichzeitig muss eine Wahrung des legitimen privaten Eigeninteresses der Plattformen und – ähnlich wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk – eine staatsferne Regulierung gewährleistet sein.

Die Leopoldina Akademie hat in einer aktuellen Stellungnahme einen Vorschlag entwickelt, wie man diesen Anforderungen gerecht werden kann:
Ein auf Dauer institutionalisiertes, unabhängiges und pluralistisch besetztes Aufsichtsgremium mit Vertreter:innen aus Zivilgesellschaft, Politik und der Nutzerschaft sollte die Kuratierungspraxis der Plattformen beaufsichtigen und ein vielfältiges Themen- und Positionsangebot sicherstellen. Dafür sollte es gegenüber den Plattformen verbindlich entscheidungsbefugt sein.
Das Facebook Oversight Board – das nur in Einzelfällen von gelöschten Inhalten oder gesperrten Accounts verbindlich entscheiden kann und für weiterreichende Eingriffe lediglich Empfehlungen abgibt – ist ein erstes, zeitlich vorerst begrenztes Experiment für ein solches Gremium.
Könnten Maßnahmen wie das Onlinezugangsgesetz und die angestrebte Digitalisierung von Behörden die Demokratie stärken?
Ja, wenn auch vermutlich eher in begrenztem Umfang. Eine stabile politische Kultur und die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie hängen von vielen Faktoren ab, darunter auch von den Erfahrungen im konkreten Kontakt mit dem Staat und der Leistungsfähigkeit der Verwaltung.
Einen größeren Einfluss dürften allerdings andere Faktoren haben: Zum Beispiel responsivere politische Entscheidungen, ein diverseres politisches Personal oder Erfahrungen politischer Selbstwirksamkeit durch die erfolgreiche Teilnahme an demokratischen Verfahren. Diese „analogen“ Defizite im Funktionieren der Demokratie für nennenswerte Teile der Bevölkerung lassen sich nicht einfach durch Digitalisierung lösen.
Gleichzeitig ist eine effiziente, gut erreichbare Verwaltung natürlich auch ein Wert an sich – und übrigens ein Recht in der Charta der EU-Grundrechte. Hier sind User-zentrierte Designprinzipien hilfreich. Es findet sich etwa in den Website-Designs von Behörden nach wie vor eine große Spannweite: Wird die interne Struktur der Verwaltung einfach nur online abgebildet oder werden die potenziellen Anliegen der Nutzer:innen tatsächlich als Ausgangspunkt genommen?
Wie schätzen Sie die Auswirkungen von digitalen Entscheidungshilfen vor Wahlen ein?

Digitale Entscheidungshilfen oder Voting Advice Applications (VAA) wie der Wahl-O-Mat können meiner Meinung nach ein vergleichsweise niedrigschwelliger Einstieg sein, um über die eigenen politischen Positionen nachzudenken und sich mit Freund:innen und Bekannten über die Ergebnisse auszutauschen. Anschließend kann man sich über die individuelle Gewichtung der Themen, die Kandidat:innen der Parteien sowie über strategische Aspekte der eigenen Stimmabgabe – etwa bei der Wahl von Kleinstparteien – Gedanken machen.
Die gelegentliche Kritik an VAA, dass sie die Komplexität politischer Entscheidungen oder die personelle Komponente der Wahlentscheidung außer Acht lassen, läuft meiner Meinung nach ins Leere: Das Ziel solcher Anwendungen ist ja keine personalisierte Wahlempfehlung, sondern ein inhaltlicher Abgleich der eigenen Positionen mit denen der Parteien. Verglichen mit den Tendenzen einer weiteren Personalisierung und Konzentration auf die Kanzlerkandidat:innen im Wahlkampf sowie dem Fokus auf den neuesten Umfragen in Teilen der medialen Berichterstattung finde ich digitale Entscheidungshilfen sogar angenehm nüchtern. Sie kommen dem Ideal einer auf Inhalten basierenden Willensbildung bei gleichzeitiger großer thematischer Breite schon sehr nahe.
Für die politikwissenschaftliche Forschung – die ja beispielsweise den Wahl-O-Mat sehr intensiv begleitet – bieten VAA natürlich einen sehr interessanten Einblick in die individuelle inhaltliche Auseinandersetzung vor einer Wahl. Eine aktuelle Metastudie der Hertie School kommt zu dem Schluss, dass die Nutzung von solchen Entscheidungshilfen zur Wahlteilnahme motiviert und einen Einfluss auf die Wahlentscheidung hat; wie stark diese Effekte sind, bleibt allerdings unklar. Das politische Wissen über die verschiedenen Parteipositionen scheint sich bei den Nutzer:innen nur leicht zu erhöhen.
Welche Schwerpunkte sollte die nächste Bundesregierung beim Thema Demokratie und Digitalisierung Ihrer Meinung nach setzen?
Ich denke, das Spannungsverhältnis zwischen Demokratie und Digitalisierung muss man angemessen grundsätzlich behandeln: Die Leitprinzipien sämtlicher Digitalpolitik sollten auf Demokratisierung ausgerichtet sein. Konkret heißt das, dass ein universeller Zugang zu Infrastruktur und Inhalten sowie eine inklusive Gestaltung der Netz- und Digitalpolitik oberste Priorität haben. Zudem sollten nach wie vor bestehende Unterschiede in der Nutzung verschiedener Inhalte – etwa von Bildungs- und Unterhaltungsangeboten – zielgerichtet verringert werden. Das Hans-Bredow-Institut hat gerade für die UNESCO erhoben, wo Deutschland in diesen Bereichen steht und konkrete Empfehlungen zur Verbesserung entwickelt.

Der universelle Zugang zur Infrastruktur spielt vor allem in der IT-Sicherheitspolitik eine Rolle, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit von Endgeräten. Eine Geheimhaltung und Nutzung von Sicherheitslücken zur staatlichen Überwachung ist meiner Meinung nach nicht angemessen. Ich möchte noch nicht einmal so weit gehen, den Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten ein legitimes Interesse an technischen Überwachungsmöglichkeiten abzusprechen, halte eine Gefährdung sämtlicher Endgeräte durch absichtlich offen gehaltene Lücken jedoch nicht für verhältnismäßig. Hier sollte eine konsequente Politik sicherer Endgeräte verfolgt werden.
Die staatliche Demokratieförderung sollte meiner Meinung nach die zivilgesellschaftliche Entwicklung und den Einsatz von digitalen Instrumenten (Civic Tech) stärker finanzieren und vor allem solche Projekte unterstützen, die bislang unterrepräsentierte Bevölkerungsteile ansprechen und ermächtigen. Hier sollten ähnlich wie in der Digitalisierung der Verwaltung auf Open Source gesetzt und Mittel für die Wartung und Weiterentwicklung von entsprechender Software zur Verfügung gestellt werden.
Als weitere große regulatorische Herausforderung sehe ich den Umgang mit Messengern an, die im NetzDG nicht ganz greifbar sind. Messenger mit sehr großen Gruppen oder Kanälen wie Telegram stellen Teilöffentlichkeiten her und sind daher zumindest eingeschränkt demokratierelevant. Zudem werden sie regelmäßig von extremen Akteuren genutzt, um die Content-Moderation in sozialen Netzwerken zu umgehen und spielen eine Rolle in Radikalisierungsprozessen. Gleichzeitig ist die Kommunikation in geschützten, privaten Räumen eine Grundvoraussetzung von Demokratien und von Demokratiebewegungen in autoritären Staaten. Jedes Regulierungsvorhaben in Deutschland und der EU auf diesem Feld hat deshalb internationale Signalwirkung.
Mehr Informationen:
Desinformation: So beeinflussten Desinformationen den Wahlkampf
eGovernment: Wie steht es um die Digitalisierung der Verwaltung?
Joschua Helmer: Über die politischen Digitalstrategien in Europa