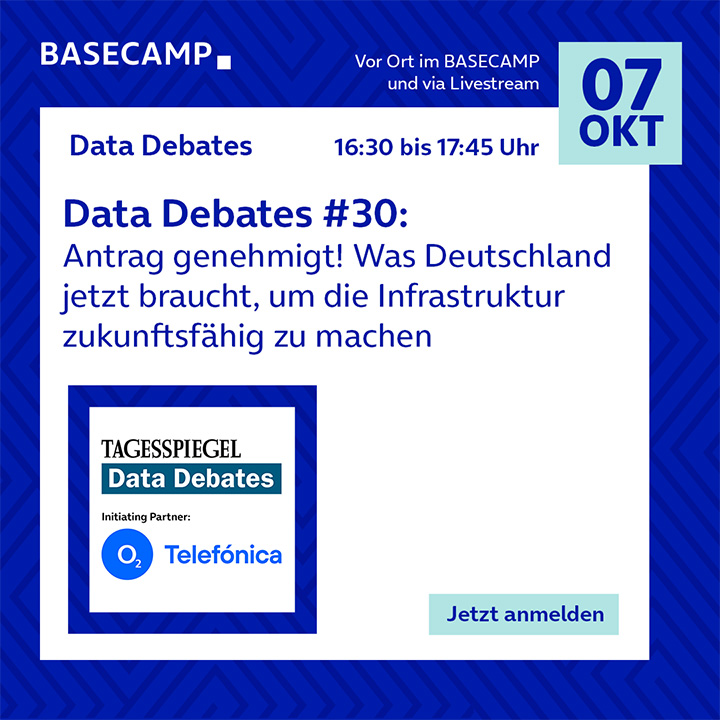Sondierung Nr. 2: Digitalpolitik in mindestens vier Arbeitsgruppen

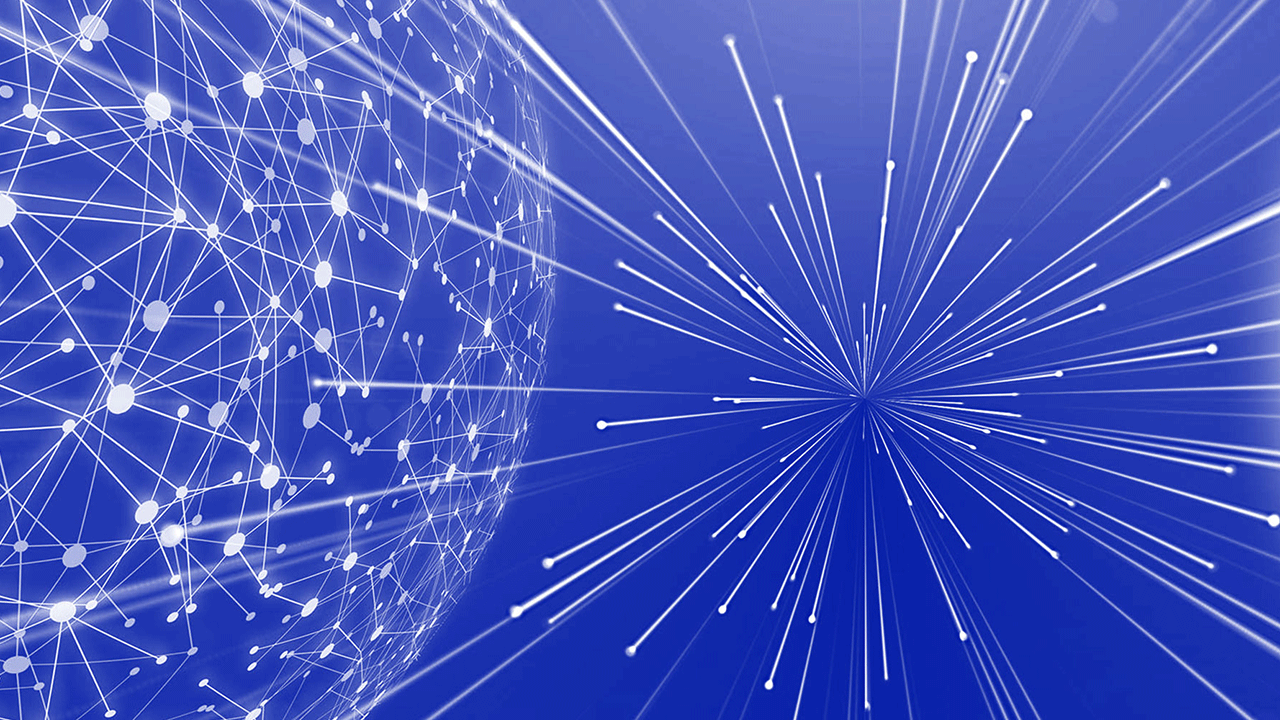
Auch bei den Sondierungsgesprächen zwischen Union (öffnet in neuem Tab) und SPD (öffnet in neuem Tab), die am 7. Januar begonnen haben, wird die Digitalpolitik in einer Reihe von Arbeitsgruppen verhandelt. Wie schon bei der Jamaika-Sondierung ist Digitalisierung also kein eigenes Schwerpunkthema. Die Mitglieder der Sondierungsgruppen wollten – im Unterschied zu den Gesprächen zwischen Union, FDP (öffnet in neuem Tab) und Grünen (öffnet in neuem Tab) – Vertraulichkeit wahren. Dennoch sickerten am Montagnachmittag erste Zwischenergebnisse durch. Ein Papier mit den gesamten Ergebnissen der Sondierung soll es laut Zeitplan nach einer „Open-End“-Sitzung der gesamten 36-köpfigen Sondierungskommission geben, die am Donnerstag, 11. Januar, um 14 Uhr beginnt.
Auf 14 inhaltliche Arbeitsgruppen und eine zur Zusammenarbeit einer möglichen Koalition haben sich die Partei- und Fraktionschefs vor Beginn der Sondierung geeinigt. Zwei davon tragen die Digitalisierung im Namen. Zum einen die Arbeitsgruppe „Wirtschaft, Verkehr, Infrastruktur, Digitalisierung, Bürokratie“. In ihr verhandeln für die CDU der baden-württembergische Innen- und Digitalisierungsminister Thomas Strobl (öffnet in neuem Tab) und Carsten Linnemann (öffnet in neuem Tab), Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der Union. Die CSU (öffnet in neuem Tab) wird vertreten vom CSU-Landesgruppenchef und früheren Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (öffnet in neuem Tab), seinem Vorgänger, dem Bundestagsabgeordneten Peter Ramsauer (öffnet in neuem Tab) und der bayerischen Ministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, Ilse Aigner (öffnet in neuem Tab). Für die SPD sitzen der hessische Fraktions- und Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel (öffnet in neuem Tab), die saarländische Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr, Anke Rehlinger (öffnet in neuem Tab), und der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Sören Bartol (öffnet in neuem Tab) in der Arbeitsgruppe.
Zum anderen ist die Arbeitsgruppe „Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht, Digitalisierung“ schon vom Namen her „digital.“ Die CDU-Mitglieder sind Helge Braun (öffnet in neuem Tab), Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, und Karl-Josef Laumann (öffnet in neuem Tab), Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein Westfalen. Für die CSU sondieren der parlamentarische Geschäftsführer der Landesgruppe, Stefan Müller (öffnet in neuem Tab), und Emilia Müller (öffnet in neuem Tab), Staatsministerin für Arbeit und soziales, Familie und Integration in München. Die Fraktionsvorsitzende und ehemalige Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (öffnet in neuem Tab) verhandelt zusammen mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Deyer (öffnet in neuem Tab) in dieser Arbeitsgruppe für die SPD. Dreyer brachte sich vor Beginn der Sondierung mit einer digitalpolitischen Forderung auf Bundesebene zu Wort: In einer Pressemitteilung (öffnet in neuem Tab) schlägt sie vor,
„eine bundesweite Zertifizierung von Algorithmen sowie eine Beschwerdestelle für Nutzerinnen und Nutzer einzuführen“.
In der Mitteilung begrüßt Dreyer das Thesenpapier (öffnet in neuem Tab) „Algorithmenbasierte Entscheidungsprozesse“ des vzbv (öffnet in neuem Tab).
Bundes- und Landesinteressen bei der Bildungspolitik

In der Arbeitsgruppe „Bildung/Forschung“ dürfte es spannend werden, wie die Bundes- und Landespolitiker ihre unterschiedlichen Interessen miteinander in Einklang bringen. so ist nach wie vor unklar, was aus dem Digitalpakt wird – der Initiative mit der Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (öffnet in neuem Tab) (CDU) den Ländern fünf Milliarden Euro für Ausstattung der Schulen in den nächsten fünf Jahren versprochen hatte. Der CDU-Chefverhandler in der Arbeitsgruppe, Helge Braun, hatte Anfang Dezember in einem Interview mit der Märkischen Oder-Zeitung/Südwestpresse (öffnet in neuem Tab) gefordert, die Vereinbarungen mit den Ländern „weiterzuentwickeln, u.a. um eine bundesweit einheitliche Bildungscloud zu schaffen“. Neben ihm vertritt der neue sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (öffnet in neuem Tab) die CDU in der Bildungs-AG. Auch CSU und SPD lassen jeweils einen Bundes- und einen Landespolitiker verhandeln: die CSU Stefan Müller und den bayerischen Kultusminister Ludwig Spaenle (öffnet in neuem Tab) und die SPD die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (öffnet in neuem Tab), und den für Wirtschaft und Energie, Bildung und Forschung zuständigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Hubertus Heil (öffnet in neuem Tab).
Atmosphärisch interessant werden dürfte die Arbeitsgruppe Innen und Recht. Bei den Jamaika-Verhandlungen wurden einige netzpolitische Themen in dieser Arbeitsgruppe behandelt. Bei der neuen Groko-Sondierung treffen hier Thomas Strobl und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (öffnet in neuem Tab) für die CDU sowie der bayerische Innenminister Joachim Hermann (öffnet in neuem Tab) und Stephan Mayer für die CSU auf den SPD-Linken und schleswig-holsteinischen Landes- und Fraktionsvorsitzenden Ralf Stegner (öffnet in neuem Tab) sowie die stellvertretende Vorsitzende der SPD Bundestagsfraktion Eva Högl (öffnet in neuem Tab).
Beschlüsse der CSU-Klausur im Kloster Seeon
Dass Digitalpolitik weiter ein Querschnittsthema ist, wird nicht nur aus der Zusammensetzung der Sondierungs- Arbeitsgruppen deutlich, sondern auch aus den Beschlüssen der CSU-Bundestagsabgeordneten bei ihrer Klausur im Kloster Seeon vom 4. bis zum 6. Januar. Die Digitalpolitik ist Thema in vier Beschlüssen: Im Papier zur Wirtschaftspolitik (öffnet in neuem Tab), zur Strukturpolitik (öffnet in neuem Tab), zur Bildungspolitik (öffnet in neuem Tab) und zum Rechtsstaat (öffnet in neuem Tab). Viele der Forderungen sind bereits im gemeinsamen Wahlprogramm mit der CDU oder im eigenen Bayernplan enthalten. Bei zwei Themen setzen die Christsozialen jetzt aber noch einmal Akzente. Im Beschluss zur Strukturpolitik erheben sie die Forderung:
„Wir wollen kurzfristig alle Funklöcher schließen“.
Die Bundesnetzagentur (öffnet in neuem Tab) (BnetzA) müsse gemeinsam mit den Mobilfunkanbietern konsequent für die Schließung der vorhandenen Funklöcher sorgen und die Erfüllung der Versorgungsauflagen überwachen. […]
Open Data für alle Parkplätze bis 2025
Im Beschluss zur Wirtschaftspolitik stellen die CSU-MdB beim Thema Mobilität 4.0 weitreichende Forderungen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur und zu open Data:
„Bis 2025 wollen wir […] alle Ampeln und Verkehrszeichen vernetzungsfähig machen, alle Parkplätze mit Sensorik ausstatten und deren Daten offen zur Verfügung bereitstellen. Auch im Öffentlichen Personennahverkehr sollen alle Daten in Echtzeit offen zur Verfügung stehen.“
Der Digitalpakt wird im Beschluss zur Bildungspolitik nicht erwähnt. Die Rede ist von einem Bundesprogramm, mit dem „Gigabit-Anschlüsse und freies WLAN“ in jeder Schule gefördert werden. Eine Summe dafür wird nicht genannt. Die Schaffung einer
„innovativen neuen Bildungs-Cloud durch den Bund, mit der wir über Deutschland hinaus neue Maßstäbe setzen wollen, will die CSU unterstützen“.
Im Rechtsstaat-Papier fordert die CSU einen bundesweiten Ausbau der Videoüberwachung und will zusätzliche Fahndungsmöglichkeiten durch automatische Gesichtserkennung schaffen.
cnetz-Forderungen zur Sondierung
Vor dem Start der Sondierung hat cnetz (öffnet in neuem Tab), der CDU-nahe Verein zur Digitalpolitik seine Forderungen veröffentlicht. Das Papier (öffnet in neuem Tab) beschäftigt sich mit einigen Bereichen der Netzpolitik:
• Smart und open Data
• Digitale Bildung und Forschung
• Fokussierung eMobility und smart Cities
• Cyberkriminalität und Überprüfung bestehender Gesetze
• Digitale Spiele, Serious Games und eSport lauten die Überschriften der Abschnitte.
Das cnetz begrüßt die Standards für Datensicherheit in den Entwürfen der E-Privacy-Verordnung, warnt aber, die Verordnung dürfe bei den Regelungen zur Datenverarbeitung nicht hinter die Datenschutz-Grundverordnung zurückfallen. Beim Datenschutz möchte der Verein, das Thema Daten-Innovation in den Vordergrund rücken. es soll Teil des Auftrages der Bundesdatenschutzbeauftragten werden, damit sie „eine bessere Abwägung bei Entscheidungen“ treffen könne.
Zu den Gesetzen, die cnetz überprüfen bzw. abschaffen lassen möchte, gehören das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das Leistungsschutzrecht.
Beim Thema digitale spiele fordert der Verein international konkurrenzfähige Förderangebote. eSport sollte mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. es sei absehbar, dass eSport mittelfristig in seiner global zunehmenden Bedeutung auch in den olympischen Kanon aufrücken werde. „ein frühzeitiges Engagement wird sich auszahlen“, heißt es in dem Papier.
Der vorstehende Artikel erscheint im Rahmen einer Kooperation mit dem Tagesspiegel Politikmonitoring auf UdL Digital. Sascha Klettke ist Chef vom Dienst und Analyst für Netzpolitik.