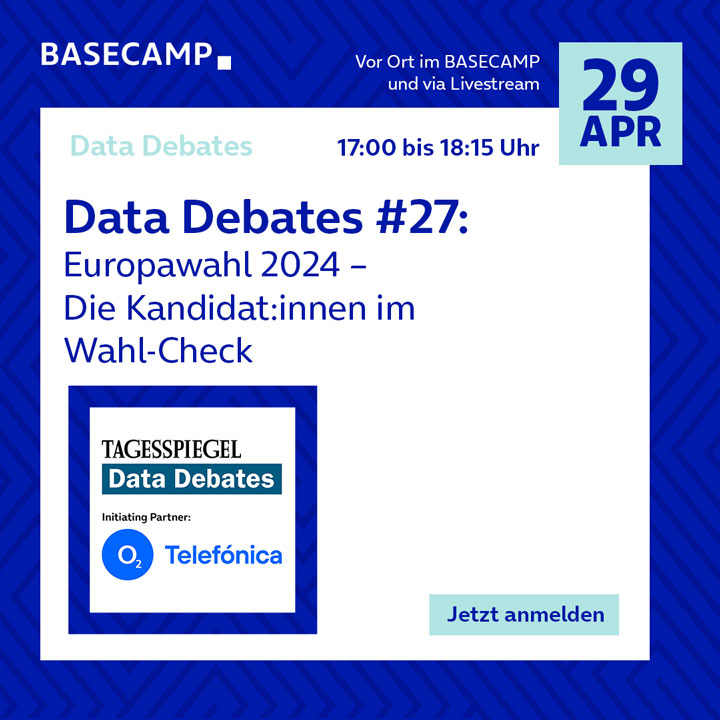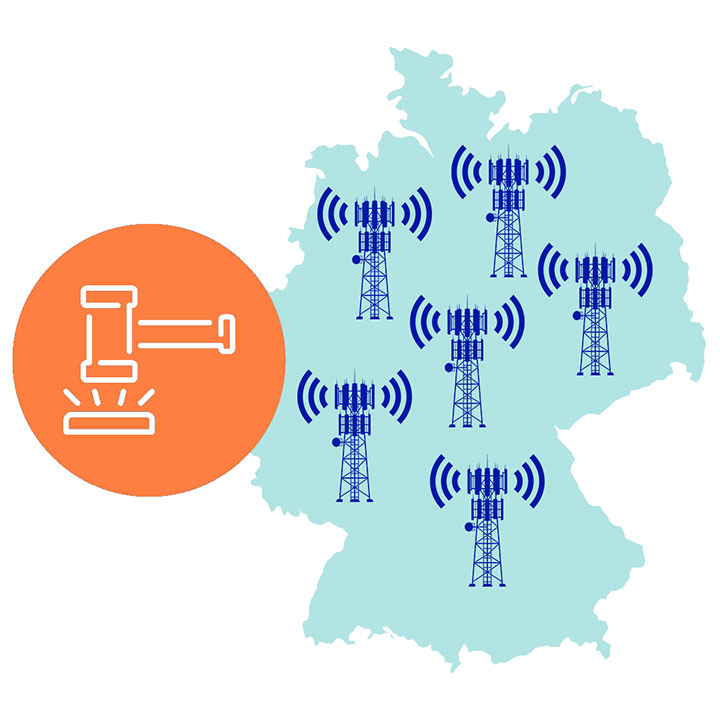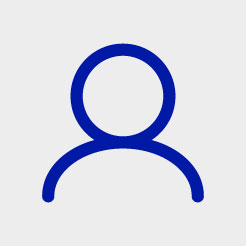Serie zur Europawahl: Digitalisierung in Grün

Vom 23. bis 26. Mai wird von Lissabon bis Riga zum neunten Mal das Europäische Parlament (öffnet in neuem Tab) gewählt – in Deutschland liegt der Wahltermin (öffnet in neuem Tab) auf dem 26. Mai. Vor dem Hintergrund des Brexit und der Debatte zur Reform der Europäischen Union gerät die anstehende Wahl noch einmal mehr zu einer Richtungsentscheidung. Erstmals seit 1979 könnten die europäischen Parteienfamilien von Christ- (EVP (öffnet in neuem Tab)) und Sozialdemokraten (S&D (öffnet in neuem Tab)) gemeinsam keine Mehrheit mehr im EU-Parlament haben, womit sich dessen Machtgefüge verändern würde. In einer Serie gucken wir uns daher an, mit welchen digitalpolitischen Positionen die deutschen Parteien in den Europawahlkampf ziehen. Wir starten mit dem Programm von Bündnis 90/Die Grünen (öffnet in neuem Tab). Die Programme der weiteren Parteien greifen wir in den kommenden Wochen und Monaten mit ihrer Veröffentlichung auf.
Für eine europäische Digitalpolitik

Aus Sicht der Grünen ist in der Digitalpolitik ein europäischer Ansatz essentiell. Die Europäische Union (öffnet in neuem Tab) könne „die digitale Welt zivilisieren“ und gleichzeitig die Chancen der digitalen Entwicklung durch gemeinsame Förderung und Wissenstransfer nutzen. Was die Infrastruktur anbelange, sei eine „umfassende europäische Investitionsoffensive“ notwendig, um „Investitionslücken von Hunderten Milliarden Euro“ zu schließen und eine „flächendeckende digitale Infrastruktur“ zu schaffen. Der europäische Ansatz soll auch im Umgang mit großen Digitalkonzernen wie Google, Facebook und Amazon umgesetzt werden, um deren „digitale Marktmacht“ zu regulieren. Hierfür soll unter anderem ein europäisches Kartellamt als Digitalaufsicht geschaffen werden. Zusätzlich fordern die Grünen eine „am Umsatz orientierte europäische Digitalsteuer“. Die daraus erzielten Einnahmen sollen in die Finanzierung öffentlicher Aufgaben fließen.
Datenschutz
Auch das Thema Datenschutz spielt eine zentrale Rolle im Europawahlprogramm der Grünen. Das „informationelle Selbstbestimmungsrecht“ sieht die Partei als ein „zentrales Grundrecht“. Sie verweist zudem auf die „von den europäischen Grünen hart erkämpfte“ Datenschutzgrundverordnung (öffnet in neuem Tab) (DSGVO) – ein „Meilenstein für modernen Datenschutz“. Die Umsetzung der Verordnung wollen die Grünen genau verfolgen. Zudem unterstützen sie die „E-Privacy-Verordnung (öffnet in neuem Tab)„, die aktuell auf europäischer Ebene verhandelt wird. Der Verordnungsentwurf sieht unter anderem vor, die Produktion mobiler Endgeräte an den Grundsätzen „Privacy by design (öffnet in neuem Tab)“ und „Privacy by default“ auszurichten. Das heißt, dass Datenschutz schon durch entsprechende Maßnahmen in der Produktion oder Entwicklung gewährleistet wird. Außerdem soll die Interoperabilität bei digitalen Plattformen verbessert werden. Ziel ist, dass bei einem Wechsel eines Plattformanbieters die Daten vom Verbraucher problemlos mitgenommen werden können.
IT-Sicherheit
Um neben den Datenschutz auch die IT-Sicherheit zu stärken, fordern die Grünen die „verbindliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (öffnet in neuem Tab) als Standard unserer elektronischen Kommunikation“. Außerdem soll es „verpflichtende Mindeststandards“ bei technischen Geräten geben, um IT-Sicherheit zu garantieren. Allgemein soll die öffentliche Hand „bei der IT-Sicherheit Vorreiter sein“. So müsse auch bei der Etablierung von E-Government-Angeboten auf höchste Datenschutz- und Sicherheitsstandards gesetzt werden.
Transparenz und Gleichheit
Auf Algorithmen basierende Entscheidungen müssen laut Grünem-Wahlprogramm sowohl transparent und überprüfbar werden als auch Diskriminierung vermeiden. Wenn notwendig, bedürfe es der Kontrolle durch staatliche Behörden. Auch das Thema Chancengleichheit in der Digitalisierung thematisieren die Grünen: So will die Partei unter anderem mehr Frauen in digitale Berufe bringen. Außerdem sollen „spezialisierte Schiedsstellen und ein erweitertes Verbandsklagerecht“ geschaffen werden, um Diskriminierung durch Algorithmen entgegenzuwirken. Weiter wird auf die europäische Barrierefreiheits-Richtlinie verwiesen, die auch für sämtliche digitale Angebote gelte. Die Grünen erachten es für „unumgänglich, auch für die Privatwirtschaft verbindliche Vorgaben für die Barrierefreiheit zu formulieren“.
Der vorstehende Artikel erscheint im Rahmen einer Kooperation mit dem Tagesspiegel Politikmonitoring (öffnet in neuem Tab) auf UdL Digital (öffnet in neuem Tab). Christian Krug schreibt als Redakteur zur Digitalpolitik.