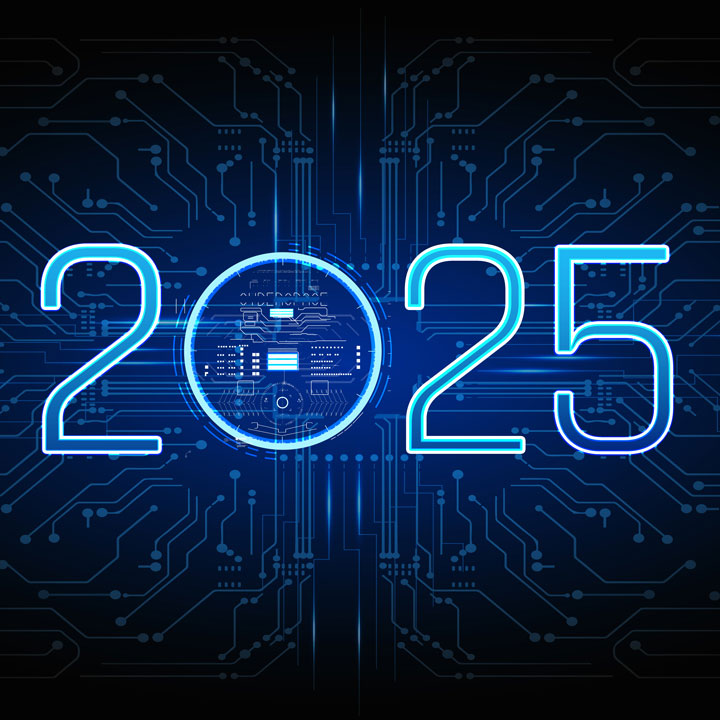Digitalisierte Nachhaltigkeit und nachhaltige Digitalisierung: Was Union und SPD jetzt angehen sollten


Digitalisierung bekommt ein eigenes Ministerium, der Klimaschutz wandert zurück ins Umweltressort – und gerät aus dem Blickfeld? Beide Bereiche und ihre Schnittmengen sind jedoch entscheidend für eine zukunftsgerecht aufgestellte Wirtschaft. Ein Überblick, was die neue Bundesregierung im Feld der “Twin Transition” vorhat und vorhaben sollte, um Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutzziele zu wahren.
Mit dem neuen Koalitionsvertrag (öffnet in neuem Tab) von CDU/CSU und SPD ist die politische Agenda für die kommenden Jahre umrissen, doch der Teufel steckt im Feintuning. Die Koalition will Deutschland auf die „digitale Überholspur“ bringen, KI-Nation werden und zugleich die Klimaneutralität bis 2045 erreichen. Doch wie gut gelingt es, Klimapolitik und Digitalisierung wirklich zu verzahnen? Ein Blick auf Chancen und Schwachstellen im Vertrag und die Potenziale für die Umsetzung.
Was sieht der Koalitionsvertrag vor?
Der aktuelle Koalitionsvertrag bekennt sich zum Klimaziel der Klimaneutralität bis 2045, wobei technologischer Fortschritt und Innovationen eine zentrale Rolle spielen sollen. Die Kreislaufwirtschaftsstrategie soll weiter verfolgt und durch kurzfristig anvisierte Maßnahmen gestärkt werden. Zudem werden Ansätze zur Abfallvermeidung, der verstärkte Einsatz von Rezyklaten sowie zirkuläre Geschäftsmodelle, etwa in der Shared Economy, als förderwürdig benannt.

Auf EU-Ebene unterstützt die Bundesregierung das sogenannte Omnibus-Verfahren, das unter anderem auf eine Vereinfachung von Nachhaltigkeitsberichtspflichten abzielt. Eine Abschaffung des nationalen Lieferkettengesetzes zugunsten der europäischen Regelung wird in Aussicht gestellt. Im Bereich nachhaltiger Digitalisierung wird angestrebt, Rechenzentren durch die erleichterte Nutzung von Abwärme effizienter zu gestalten. Darüber hinaus bekennt sich die Bundesregierung zur Förderung ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit bei der Entwicklung von Schlüsseltechnologien. Kurzum: durchaus vielversprechende Maßnahmen, jedoch sowohl in Anzahl als auch Konkretisierung von Ausgestaltung und Zielsetzung nicht gerade umwerfend.
Offene Fragen und Kritik
Trotz der formulierten Ambitionen fehlt es dem Koalitionsvertrag in vielen Bereichen an klaren Umsetzungspfaden und verbindlichen Zeitplänen. So fällt etwa im Bereich der Kreislaufwirtschaft die Priorisierung einseitig aus: Der Fokus liegt auf Reparaturmaßnahmen, während zentrale Ansätze wie Re-Use oder Refurbishment oder sogar Vermeidung kaum berücksichtigt werden. Nachhaltigkeitsaspekte neuer Technologien – insbesondere im Bereich Künstlicher Intelligenz – bleiben vollständig außen vor. Die scharfe Kritik von Umweltverbänden kommt daher nicht überraschend. Stefanie Langkamp von der Klima-Allianz Deutschland hat in diesem Zusammenhang erhebliche Zweifel (öffnet in neuem Tab) geäußert. Sie kritisierte, dass der Koalitionsvertrag in Bezug auf Rückschritte klare Aussagen trifft, während konkrete Fortschritte vage bleiben.
Auch die systematische Verknüpfung von Digitalisierungs- und Klimapolitik bleibt weitgehend unbeachtet. Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden sowohl inhaltlich als auch organisatorisch getrennt gedacht. Das zeigt sich unter anderem im aktuellen Organisationserlass: Dem CDU-Digitalministerium von Karsten Wildberger sind vor allem Aufgaben der Verwaltungsmodernisierung zugewiesen, während umweltbezogene Digitalthemen keine Rolle spielen. Gleichzeitig übernimmt das SPD-geführte Umweltministerium von Carsten Schneider erneut Zuständigkeiten, die zuvor dem Wirtschaftsministerium, das nun von Katherina Reiche geführt wird, zugeordnet waren – nicht gerade ein Zeichen für einen integrierteren Politikansatz. Ein koordiniertes Zusammendenken ökologischer und digitaler Transformation lässt sich daraus also kaum ableiten – da wird es nicht viel helfen, das ausgerechnet das erste Kabinettsselfie (öffnet in neuem Tab) Digitalminister Wildberger und Umweltministerin Schneider als Sitznachbarn zeigt.
Unsicherheit als Hemmnis für Unternehmen

Der Koalitionsvertrag sendet somit ein weiteres Signal regulatorischer Unsicherheit an Unternehmen. Bereits vor der Bundestagswahl waren die negativen Effekte dieser Unsicherheit (öffnet in neuem Tab) auf die Nachhaltigkeitstransformation der Wirtschaft spürbar – wie der Sustainability Transformation Monitor 2025 der Bertelsmann Stiftung zeigt. In vielen Bereichen der Realwirtschaft stagniert der Transformationsprozess. Besonders alarmierend: Von den Unternehmen, die im Vorjahr noch konkrete Klimaziele formuliert hatten, haben bislang nur 13 Prozent diese auch tatsächlich umgesetzt. Die mangelnde Klarheit bei politischen Vorgaben und gesetzlichen Rahmenbedingungen bremst unternehmerische Nachhaltigkeitsbemühungen nachweislich. Zugleich verliert das Thema Nachhaltigkeit bei Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zunehmend an Bedeutung, ein weiterer Stolperstein auf dem Weg zur klimaneutralen Wirtschaft. Nur unter klaren Rahmenbedingungen können Unternehmen zukunftsfähige Investitionen tätigen und Innovationen entwickeln, die für das Erreichen der Klimaziele entscheidend sind.
Klimaschutz verliert an Priorität
Laut einer aktuellen Studie (öffnet in neuem Tab) des Umweltbundesamts ist das Thema Umwelt- und Klimaschutz auch in der Bevölkerung kein klar dominierendes Anliegen mehr. Nur noch 54 Prozent der Menschen in Deutschland halten Klimaschutz für „sehr wichtig“ – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu früheren Jahren. Weitere 34 Prozent bewerten ihn immerhin als „wichtig“. Trotz der sinkenden Priorität erkennt die Mehrheit weiterhin einen Zusammenhang zwischen Umweltpolitik und der eigenen Lebensqualität – doch der Stellenwert scheint im Alltag vieler Menschen zunehmend zu verblassen.
Damit die Nachhaltigkeitstransformation neuen Schwung bekommt, braucht es jetzt klare Zukunftsbilder, verlässliche Rahmenbedingungen und gezielte Impulse. Ein beschleunigtes Omnibusverfahren auf EU-Ebene kann helfen, unternehmerische Unsicherheiten zu nehmen und gleichzeitig insbesondere KMU zu entlasten und somit Klimaschutz gemeinsam zu stärken.
Auch die Kreislaufwirtschaft bietet großes Potenzial, wenn sie über Abfall- und Recyclingfragen hinausgedacht wird. Alle zirkulären Ansätze gezielt gefördert und durch klare regulatorische wie finanzielle Rahmenbedingungen gestützt. Insbesondere digitale Lösungen, wie Digital Product Passports, können dabei als Hebel dienen, um Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit zu verbinden.
Ein wichtiger Schlüssel könnte auch in einer zentralen Digitalisierungsstrategie für Nachhaltigkeit liegen. Durch die gezielte Öffnung und Nutzung staatlicher Datenbestände können Umweltinnovationen vorangetrieben und neue, nachhaltige Geschäftsmodelle ermöglicht werden. Offene Daten können Transparenz schaffen, Kooperation erleichtern, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland stärken und zudem bei der Erreichung der Klima- und Umweltziele eine entscheidende Rolle spielen.
Ressortübergreifende Abstimmung
Will die Bundesregierung die doppelte Transformation wirksam vorantreiben, muss sie Unsicherheit aktiv abbauen und die politischen Weichen so stellen, dass digitale und ökologische Zukunftsthemen zusammen angegangen werden. Eine entscheidende Rolle kommt dabei den entsprechenden Minister:innen zu, die ressortübergreifend Verantwortung übernehmen müssen. Umweltminister Schneider bringt pragmatische Verwaltungs- und Regierungserfahrung mit, bleibt jedoch inhaltlich in Bezug auf Klima- und Umweltthemen bislang ein relativ unbeschriebenes (öffnet in neuem Tab) Blatt. Wirtschaftsministerin Reiche verfolgt eine technologieoffene Linie, zeigt aber auch Skepsis (öffnet in neuem Tab) gegenüber bisherigen Klimaschutzprioritäten. Digitalminister Wildberger wiederum hat ein Gespür (öffnet in neuem Tab) für nachhaltige IT-Initiativen, steht jedoch vor allem vor der Mammutaufgabe, die stockende Verwaltungsdigitalisierung endlich voranzubringen.
Wie immer bei Koalitionsverträgen gilt: Sie setzen erste Leitplanken, sind aber noch kein fertiger Fahrplan. Doch genau hier liegt die Chance: Im konkreten Regierungshandeln können jetzt sektorale Grenzen überwunden und Zuständigkeiten klug verzahnt werden. Nur wenn dies gelingt, kann das immense Potenzial der doppelten Transformation tatsächlich gehoben werden.
Mehr Informationen:
Im Digital-Check: Das Merz-Kabinett
Neue Macht für die Digitalisierung: Wildbergers Ministerium im Überblick
Neue Bundesregierung: Digitalpolitik und Telekommunikation im Koalitionsvertrag