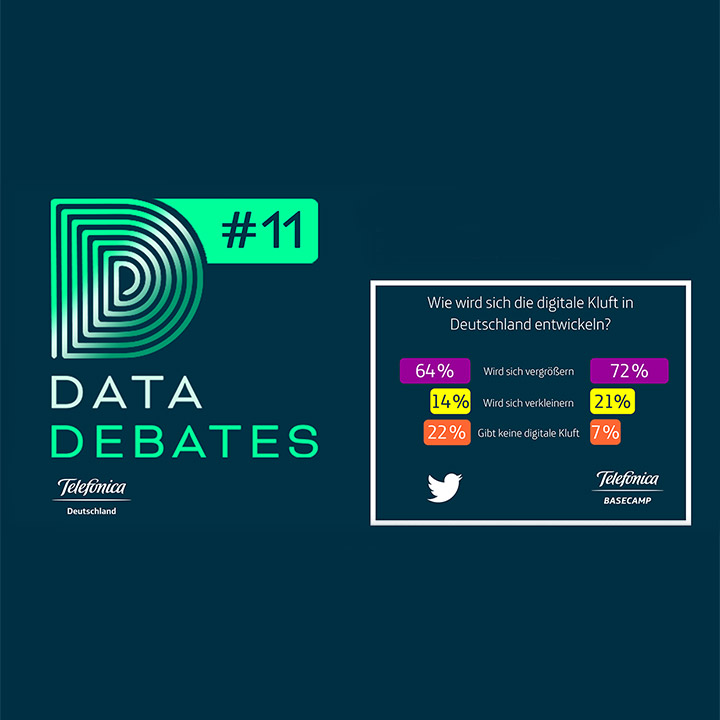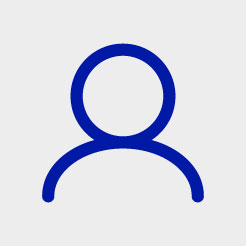Digitale Souveränität im Fokus von BMWi und BITKOM
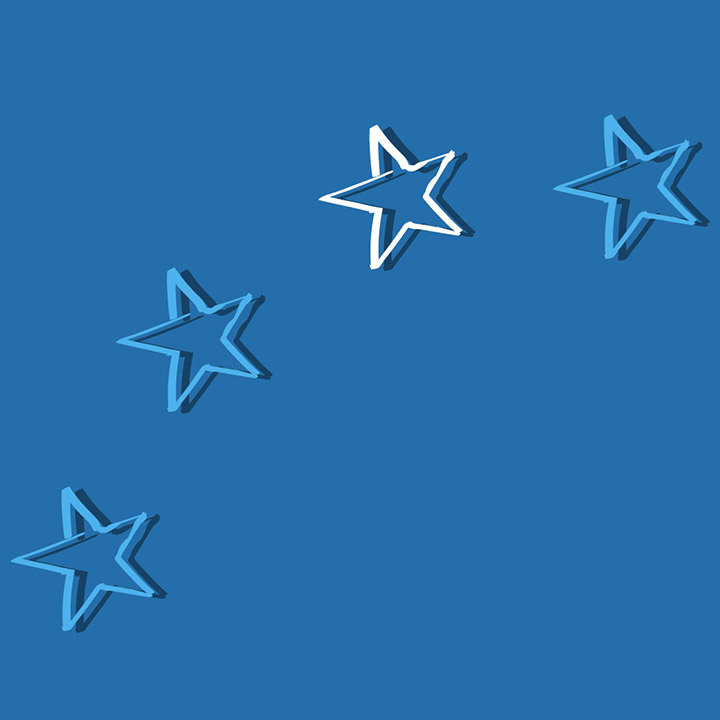
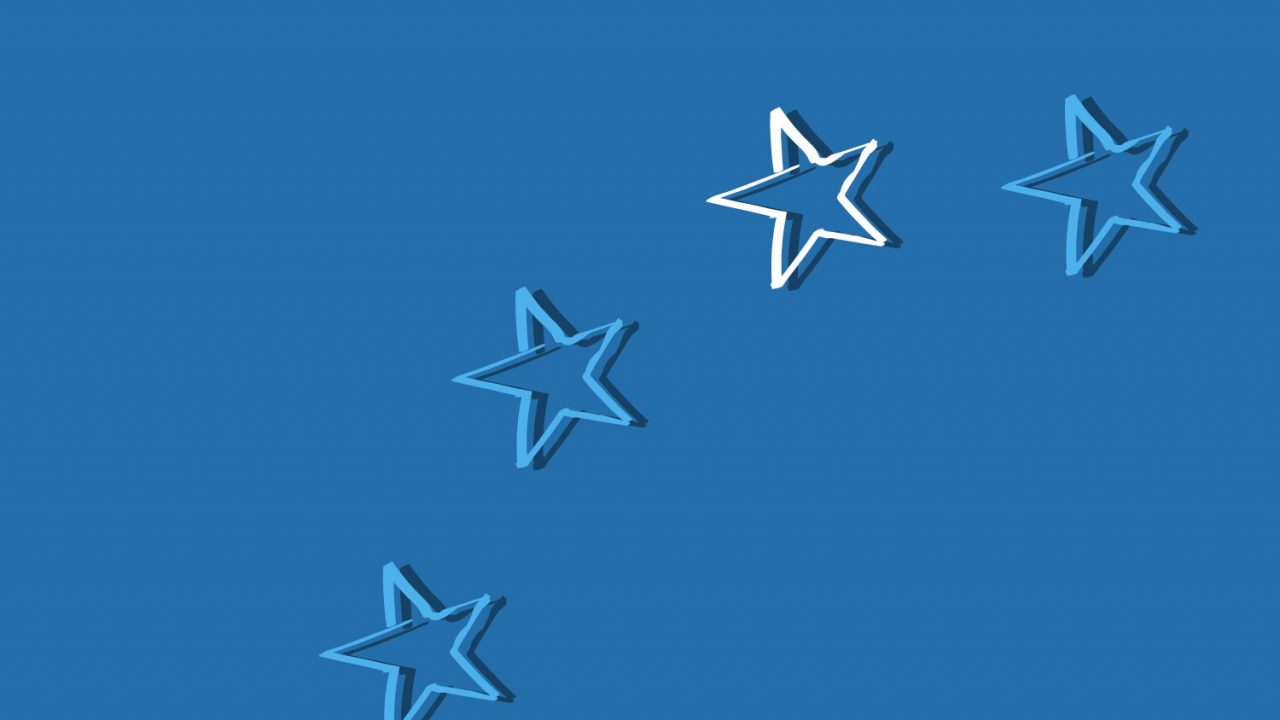
Nach der Präsentation der Arbeitsstruktur zur Digitalen Agenda im Rahmen der CEBIT hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (öffnet in neuem Tab) am Dienstag, 12.05.2015, ein Impulspapier (öffnet in neuem Tab) zum Thema „Industrie 4.0 und Digitale Wirtschaft“ anlässlich des Starts der Plattform „Industrie 4.0“ (öffnet in neuem Tab) und „Innovative Digitalisierung der Wirtschaft“ vorgelegt. Das Papier zeigt Handlungsfelder und zentrale Fragestellungen der Digitalisierung auf und konkretisiert den Maßnahmenkatalog des Bundeswirtschaftsministeriums, der in der Digitalen Agenda nur grob skizziert worden war.
Die digitale Souveränität sieht das Bundeswirtschaftsministerium (öffnet in neuem Tab) als eine entscheidende Voraussetzung für Wachstum und Beschäftigung in der digitalen Welt und widmet diesem Thema ein eigenes Kapitel in dem 30-seitigen Impulspapier. Als Attribute der digitalen Souveränität (öffnet in neuem Tab) benennt das BMWi
- den Zugang zu verifizierbar vertrauenswürdigen Technologien, mit der IT-Sicherheit gewährleistet werden kann,
- eine wirtschaftliche und technologische Marktposition, die es Unternehmen erlaubt, ihre Geschäftsmodelle unabhängig weiterzuentwickeln und
- einen modernen Ordnungsrahmen für Deutschland und Europa, der den Entwicklungen der Digitalisierung Rechnung trägt, Innovationen und neue Ideen befördert sowie gleichzeitig die hohen Standards in puncto Arbeit, Datensouveränität und selbstbestimmtes Leben schützt.
Position des BITKOM
Der Digitalverband BITKOM konstatiert seinerseits in seinem ebenfalls am 12.05.2015 präsentierten Positionspapier „Digitale Souveränität“ (öffnet in neuem Tab), dass dieser Begriff zwar häufig „überschriftenartig“ von Politikern genannt werde, es bislang aber an einer einheitlichen Definition mangele. Für den BITKOM (öffnet in neuem Tab) bedeutet „Digitale Souveränität“ die Fähigkeit zu selbstbestimmtem Handeln und Entscheiden im digitalen Raum. Digital souveräne Länder oder Regionen verfügten bei digitalen Schlüsseltechnologien und -kompetenzen über „eigene Fähigkeiten auf internationalem Spitzenniveau“. Sie seien darüber hinaus in der Lage, „selbstbestimmt und selbstbewusst zwischen Alternativen leistungsfähiger und vertrauenswürdiger Partner zu entscheiden, sie bewusst und verantwortungsvoll einzusetzen und sie im Bedarfsfall weiterzuentwickeln und zu veredeln“. Digital souveräne Systeme seien zudem in der Lage, ihr Funktionieren im Innern zu sichern und ihre Integrität nach außen zu schützen. Laut BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf (öffnet in neuem Tab) gehe es in Deutschland darum, Unabhängigkeit von einzelnen Wirtschaftsräumen, Staaten und Unternehmen bei digitalen Technologien, Diensten und Plattformen herzustellen.
Der BITKOM hat in seinem Positionspapier acht Maßnahmen zusammengestellt, mit denen dieses Ziel seiner Meinung nach erreicht werden kann. Deutschland (öffnet in neuem Tab) soll demnach Motor einer digital souveränen EU (öffnet in neuem Tab) sein und Europa „zum Heimatmarkt“ machen. Eine Vorreiterrolle Deutschlands erwartet der Digitalverband auch bei den Neugründungen. Die Bundesrepublik soll „Start-Up-Hot-Spot“ werden. Auf dem Wunschzettel des BITKOM an die Bundespolitik steht außerdem die Konzentration der Forschungsförderung auf Digitaltechnologien, das Austarieren von Datenvielfalt- und Datenschutzinteressen sowie die Entwicklung eines digitalen Bildungsideals. Darüber hinaus fordert der BITKOM, dass Deutschland seine Kommunikation optimal schützen solle und verlangt nichts Geringeres als den Aufbau der „weltweit leistungsfähigsten digitalen Infrastrukturen (öffnet in neuem Tab)“. Mit diesem Ziel nimmt er allerdings seine eigenen Mitglieder mit in die Pflicht. Die Bundesregierung (öffnet in neuem Tab) hat klar signalisiert, dass die großen deutschen Telekommunikationsunternehmen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur den Hauptanteil der Investitionen selbst tragen müssen
Ziele des BMWi für Deutschland
„Unsere Version für Deutschland“, so heißt es derweil in dem Impulspapier des Bundeswirtschaftsministeriums, „ist keine bloße Kopie des Silicon-Valley-Modells, sondern eine digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft, die zur Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts beiträgt.“ Die digitale Transformation der Wirtschaft (öffnet in neuem Tab) will das BMWi zum einen mit einer aktiven Industrie-4.0-Politik befördern. Neben der gemeinsamen Arbeit von Industrie, Gewerkschaften und Wissenschaft in der Plattform „Industrie 4.0“ will das Haus von Sigmar Gabriel Innovationsverfahren optimieren sowie Forschung und Entwicklung voranbringen. Dabei wird er sich mit der Bundesforschungsministerin Prof. Johanna Wanka (öffnet in neuem Tab) (CDU) abstimmen müssen. Zudem möchte das BMWi zusammen mit der Wirtschaft Strategien für die internationale Zertifizierung und Standardisierung auf globaler Ebene entwickeln. Bei der Zertifizierung von Trusted Clouds (öffnet in neuem Tab) ist dafür bereits ein Anfang gemacht. Auch rechtliche und technische Rahmenbedingungen für die Chancennutzung der Digitalisierung stehen auf der zu erfüllenden Maßnahmenliste des Wirtschaftsministeriums, obwohl dafür in Teilen Bundesjustizminister Heiko Maas (öffnet in neuem Tab) (SPD) zuständig ist
Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf der Unterstützung für Mittelstandsfirmen (öffnet in neuem Tab) und Start-Ups (öffnet in neuem Tab), für die gute Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen werden sollen. Das Bundeswirtschaftsministerium nennt dabei u.a. den Förderschwerpunkt „Mittelstand-Digital – IKT-Anwendungen in der Wirtschaft (öffnet in neuem Tab)“, fünf Kompetenzzentren zur KMU-Information über Industrie 4.0 sowie die Weiterentwicklung des Gründerwettbewerbs „IKT Innovativ (öffnet in neuem Tab)“. Ein weiteres Ziel des BMWi ist es, wachstumsstarken Start-ups „wieder mehr Börsengänge“ zu ermöglichen. Die digitale Transformation der Gesellschaft hat das Bundeswirtschaftsministerium ebenfalls im Blick. Hier erwähnt es neben den bereits gestarteten Initiativen zur Rechtssicherheit bei der Störerhaftung (öffnet in neuem Tab) und den laufenden Verhandlungen zur europäischen Datenschutz-Grundverordnung (öffnet in neuem Tab), für die im Kabinett allerdings Bundesinnenminister Thomas de Maizière (öffnet in neuem Tab) (CDU) zuständig ist, die Stichworte Rahmenbedingungen für Share Economy (öffnet in neuem Tab), Digital Index als jährliches Messinstrument und den gesellschaftlichen Dialog mit dem Ziel einer Charta 25.
Gabriels Pläne für Europa
Auf der europäischen Agenda von Sigmar Gabriel steht laut dem Impulspapier u.a., sich für „ausgewogene Regelungen für die gesetzliche Verankerung von Netzneutralität (öffnet in neuem Tab)“ einzusetzen. Mit dieser ungenauen Formulierung könnten sich auch die Kabinettsmitglieder einverstanden erklären, die sich wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (öffnet in neuem Tab) (CDU) und dem Bundesminister für digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt (öffnet in neuem Tab) (CSU), in der Vergangenheit für den Vorrang bestimmter Spezialdienste ausgesprochen hatten. Der Bundeswirtschaftsminister hat sich außerdem vorgenommen, die Vernetzung von nationalen Aktivitäten, etwa bei Industrie 4.0 oder Smart Services, in der EU voranbringen. Mit der IT-Gipfel-Plattform „Europäische und internationale Dimension der Digitalen Agenda“ will er zudem Impulse bei „wichtigen Querschnittsthemen wie Datenschutz, Cybersicherheit und wettbewerbspolitischer Ordnungsrahmen“ setzen.
Der vorstehende Artikel erscheint im Rahmen einer Kooperation mit dem Tagesspiegel Politikmonitoring (öffnet in neuem Tab) auf UdL Digital (öffnet in neuem Tab). Nadine Brockmann ist als Analystin für das Themenfeld Netzpolitik verantwortlich.