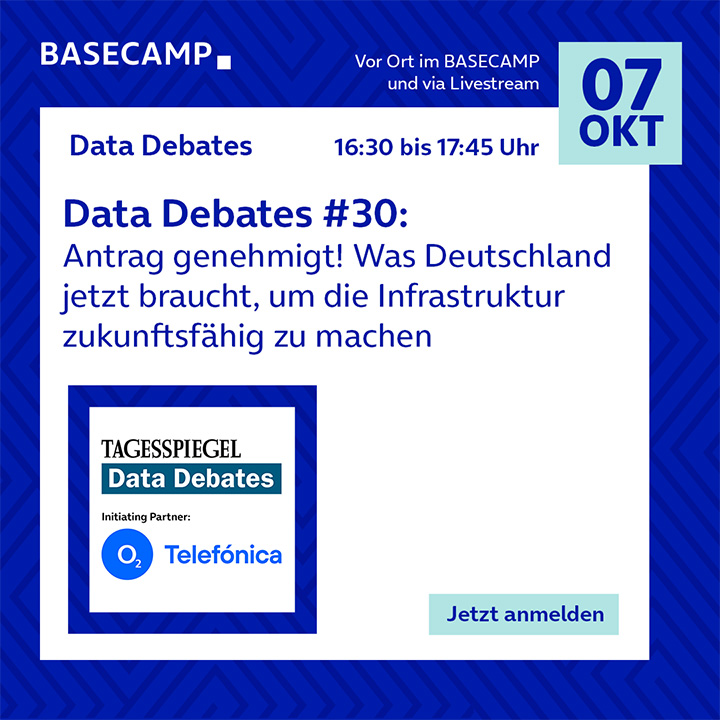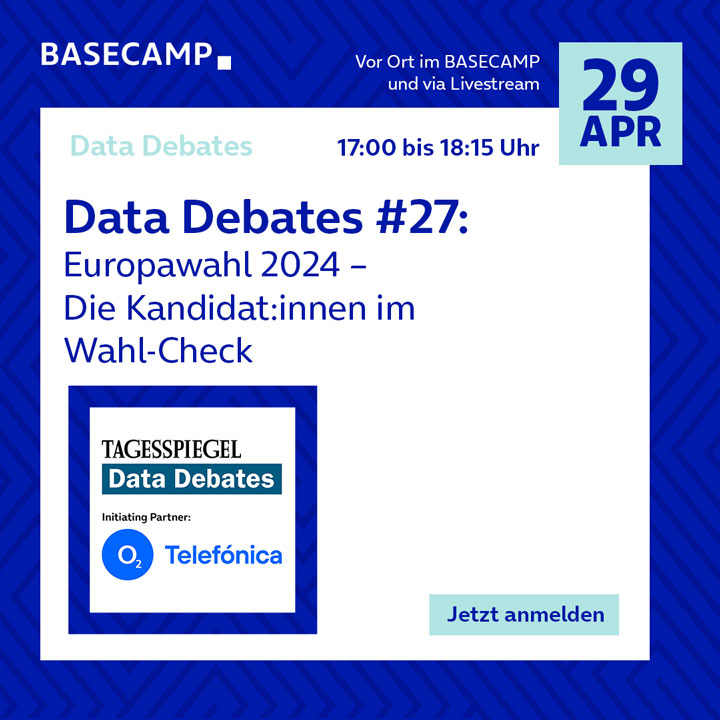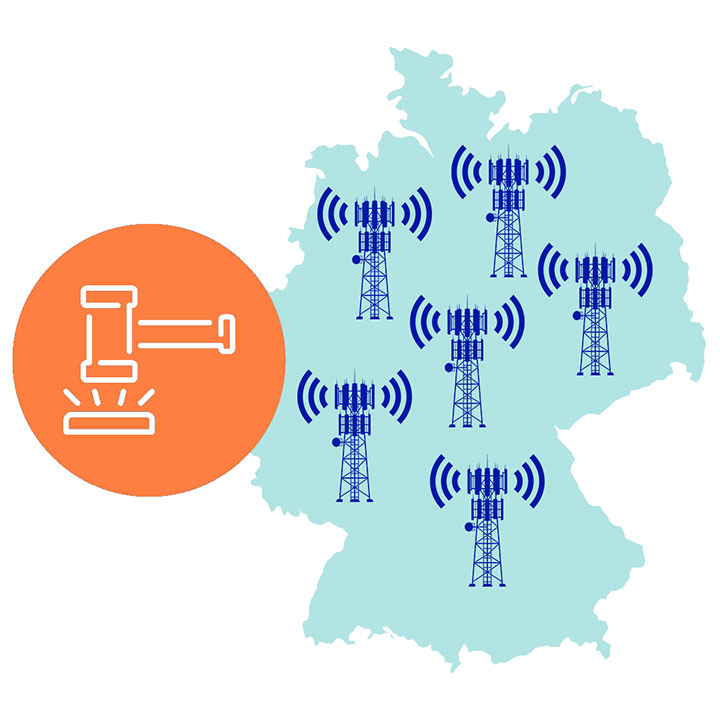Zwischen Symbolpolitik und Aufbruch: Europas Suche nach digitaler Souveränität


Digitalpolitik ist Machtpolitik: Diese Realität hat es sogar in den Koalitionsvertrag (öffnet in neuem Tab) von Union und SPD geschafft. Dass dieser Satz mehr als nur eine Floskel ist oder vielmehr sein sollte, wird in Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen zunehmend deutlich. Um den Worten Taten folgen zu lassen, haben Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron am 17. und 18. November (öffnet in neuem Tab) zum europäischen digitalpolitischen Gipfeltreffen eingeladen. Es ging um nichts Geringeres als den Weg zur digitalen Souveränität der Europäischen Union und den damit verbundenen Abschied aus den derzeitigen Abhängigkeiten von China, den USA und deren Technologie-Giganten. Denn Europa ist derzeit bei über 80 Prozent (öffnet in neuem Tab)seiner kritischen digitalen Technologien von Peking und Washington abhängig.
Zumindest ein erster Erfolg war schnell sichtbar: Leitmedien, Hauptnachrichtensendungen, Talkshows und Social Media Feeds griffen den Gipfel und sein Thema breit auf. Die Sichtbarkeit und die Relevanz von europäischer digitaler Souveränität war also der erste Gewinner des Gipfels. Möglicherweise trugen dazu hochkarätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei – darunter Digitalminister Wildberger und sein französisches Pendant Anne Le Hénanff. Aber wie steht es um die entsprechende Roadmap? Über 1.000 Teilnehmende aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft wagten auf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg den Blick in die Glaskugel der europäischen Digitalpolitik.
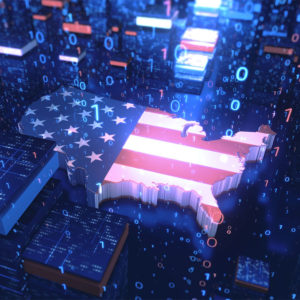
An Herausforderungen mangelt es dabei nicht: Laut einer Studie (öffnet in neuem Tab) des Digitalverbands Bitkom ist der Anteil deutscher Unternehmen, die sich für „stark abhängig“ von den USA halten, innerhalb eines Jahres von 41 auf 51 Prozent gestiegen. Konkret bedeutet das, dass Unternehmen laut eigenen Angaben lediglich zwölf Monate (öffnet in neuem Tab) ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten könnten, sollten sie aufgrund von Handelskriegen, Technologien oder Dienstleistungen aus den USA nicht mehr beziehen können. Zugleich sinkt das Vertrauen in die USA deutlich: Nur noch 38 Prozent der Unternehmen äußern Vertrauen in die Vereinigten Staaten – im Januar lag dieser Wert noch bei 51 Prozent. Die potenziellen Folgen dieser Monopolmacht sind schwindelerregend. Konkret werden die Ausmaße der geopolitischen Erpressbarkeit von CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter (öffnet in neuem Tab) ausgemalt: Amerikanische Anbieter kontrollieren die Update-Versorgung, wodurch “ein theoretischer Hebel” entsteht, Cloud-Dienste als Druckmittel einzusetzen, “wenn Donald Trump das entscheidet”.
Der vielbeschworene deutsch-französische Motor hat in der europäischen Geschichte schon einige Transformationsmeilensteine erreicht: Von der Kohle- und Stahlunion über das Deutsch-Französische Jugendwerk bis zur gemeinsamen Airbus-Produktion. Nun wollen Paris und Berlin auch im digitalen Bereich Pflöcken einschlagen. Dabei ist die Messlatte glasklar:
“Wir Europäer können und wollen bei Schlüsseltechnologien zu den Spitzenreitern gehören”,
bekräftigt Digitalminister (öffnet in neuem Tab) Karsten Wildberger.
Die Agenda: Zwischen Cloud, KI und Open Source
Die Sorgen der Europäer bilden sich im Programm (öffnet in neuem Tab) des Gipfels klar ab: Cloudsouveränität, EUDI Wallet und das Dauerthema der europäischen KI-Wettbewerbsfähigkeit waren Schwerpunkt. Dabei lautete das Motto scheinbar: “everything, everywhere all at once – aber bitte unabhängig”. Wenig überraschend fand das Kernthema Cloud-Infrastruktur (öffnet in neuem Tab) besonders viel Gehör: Neun von zehn deutschen Unternehmen nutzen Cloud-Dienste, dabei landen die meisten Daten auf Servern von Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder Google Cloud. Dass dies durchaus Grund zur Sorge sein kann, zeigt das vom Bundesinnenministerium gegründete Zentrum für Digitale Souveränität. So warnt es in einem Whitepaper (öffnet in neuem Tab) zum Souveränitäts-Washing bei Cloud-Diensten, dass alle amerikanischen Cloud Anbieter, unabhängig davon ob sie ihre Daten in oder außerhalb der USA speichern, US-Gesetzen wie dem Cloud Act, sowie jeglichen Executive Orders unterliegen. Was für eine extraterritoriale Wirkung diese Ausgangslage entwickeln kann, wurde im Fall der Kontosperrung (öffnet in neuem Tab) des Chefankläger Karim Khan des Internationalen Strafgerichtshof im Mai bereits sichtbar. Um die bereits jetzt bestehenden Risiken für Privatpersonen, Unternehmen und staatliche Institutionen zu begrenzen, fordern Deutschland und Frankreich (öffnet in neuem Tab) daher von der EU-Kommission darauf hinzuarbeiten, dass kritische Daten künftig innerhalb der EU verbleiben müssen.

Doch mit welcher Software sollen diese verwaltet werden? Hier kommen sogenannte “Open-Source-Lösungen” ins Spiel bei denen die öffentliche Verwaltung (öffnet in neuem Tab) eine besondere Rolle spielt. Mit dem deutschen “openDesk” und dem französischen “La Suite Numérique” existieren bereits funktionierende Alternativen zu Microsoft oder Google. Dass diese Arbeitsplatz Anwendungen durchaus mehr als nur Wunschvorstellung sind, zeigt das Beispiel Schleswig-Holstein, (öffnet in neuem Tab) wo Microsoft-Programme (fast) umfänglich durch Open-Source-Software ersetzt wurden.
Beim Panel mit dem verheißungsvollen Titel “Europe: The Continent of AI Opportunities”, präsentierten Unternehmen wie SAP und Mistral AI konkrete Anwendungsfälle souveräner KI mit dem stolzen Logo “Made in Europe”. Die Idee: Anhand von sechs Themen-Pavillons die zentralen Aspekte der digitalen Souveränität Europas interaktiv erlebbar machen. Exponate umfassten Prototypen von Quantentechnologien, die europäische digitale Bezahllösung WERO, sowie Photonik, Supercomputing und Green IT. Ein “Memorandum of Understanding zur erfolgreichen Einführung der EUDI-Wallet (öffnet in neuem Tab)” soll künftig europäischen Bürgerinnen und Bürger erlauben, offizielle Dokumente wie Ausweis oder Führerschein auf dem Smartphone zu speichern und zu teilen. Die bis Anfang 2027 flächendeckend eingeführte “digitale Brieftasche (öffnet in neuem Tab)” soll Identität, Authentifizierung und Verifikation digitaler Nachweise sichern und somit eine gemeinsame Infrastruktur für den digitalen Rechtsverkehr sichern.
Konkrete Maßnahmen und neue Initiativen
Im Rahmen des Gipfels wurden zahlreiche Kooperationen und Investitionen deutscher und französischer Unternehmen in den Bereichen Recheninfrastruktur, Quantentechnologie, Gesundheit, Verteidigung und Drohnen angekündigt. Besonders hervorzuheben ist die Gründung des European Network for Technological Resilience and Sovereignty (ETRS), (öffnet in neuem Tab) das am Vorabend des Gipfels von der Bertelsmann Stiftung, dem Centre for European Policy Studies (CEPS), dem AI & Society Institute und dem Polish Economic Institute ins Leben gerufen wurde.
”Europa hat den Weckruf gehört, aber es braucht größere Koordination und evidenzbasierte Politikgestaltung,”
erklärte Martin Hullin, (öffnet in neuem Tab) Direktor des ETRS-Netzwerks bei der Bertelsmann Stiftung. Das Netzwerk soll als “Bindegewebe” fungieren, das Europas fragmentierte Forschungsanstrengungen verbindet und in eine gemeinsame Vision für technologische Resilienz übersetzt. Ab 2026 werden Expert-Workshops, strategische Analysen von Technologieabhängigkeiten und ein internationaler Pool von Experten die Arbeit prägen.
Wie immer bei gemeinsamen Anstrengungen dieser Dimension, verlaufen nicht alle Initiativen nach Plan. Das einst als große europäische Cloud-Lösung gedachte Gaia-X-Projekt bleibt weit hinter den Erwartungen zurück (öffnet in neuem Tab). Ähnlich ist es bei dem von der EU-Kommission für den 19. November angekündigten „Digitale Omnibus“ – ein Gesetzespaket zur Vereinfachung von Datenschutz- und KI-Regeln. In einem offenen Brief (öffnet in neuem Tab) warnten über 120 zivilgesellschaftliche Organisationen zudem vor einer “umfassenden Deregulierungsagenda”.
Auch beim Berliner Gipfel meldete sich die Zivilgesellschaft zu Wort und präsentierte eigene Forderungen (öffnet in neuem Tab). Darunter ist eine jährliche Förderung von 30 Millionen Euro, um die technischen Grundlagen für offene, demokratische Netzwerke zu sichern. Außerdem soll mit dem “+1-Prinzip”, die Bundesregierung und öffentliche Institutionen verpflichtet werden, neben kommerziellen Plattformen mindestens eine freie, digital souveräne Alternative “gleichwertig” zu bespielen. Diese Kritik trifft einen wunden Punkt:
Was Europa nicht braucht, seien europäische Nachbildungen der Plattformen durch große Industrieanbieter, “die mit Milliarden an öffentlichen Steuergeldern finanziert werden”,
so Sandra Barthel (öffnet in neuem Tab) von der Digitalen Gesellschaft.
Startschuss oder Symbolpolitik?
Der Berliner Gipfel zur digitalen Souveränität markiert einen wichtigen politischen Moment. Mit der Unterstützung von 23 EU-Mitgliedstaaten und der Gründung neuer Netzwerke wie ETRS entstehen strukturierte Ansätze für mehr technologische Unabhängigkeit. Die Ankündigung konkreter Investitionen zeigen, dass es nicht bei reinen Absichtserklärungen bleiben soll.
Dennoch bleiben zentrale Fragen offen: Werden die angekündigten Maßnahmen ausreichen, um Europas massiven Rückstand bei KI, Cloud-Infrastruktur und Halbleitern aufzuholen? Digitalexperte Torben Klausa (öffnet in neuem Tab) mahnt zu realistischen Erwartungen:
„Wir müssen aufhören zu glauben, wir könnten von jetzt auf gleich alles an Big Tech ersetzen“.
Stattdessen gehe es darum, bestehende Alternativen zur Marktreife zu bringen und strategische Abhängigkeiten zu reduzieren.
Die Herausforderung ist immens: Europa muss gleichzeitig in Infrastruktur investieren, regulatorische Hürden abbauen, Fachkräfte ausbilden und zivilgesellschaftliche Bedenken ernst nehmen. Ob der Gipfel als Wendepunkt in die Geschichte eingeht oder als verpasste Chance, wird die Zeit zeigen – wenn aus Ankündigungen konkrete Projekte werden müssen. Der Rückstand aus Jahrzehnten wird nicht in wenigen Jahren oder gar Monaten aufzuholen sein.
Mehr Informationen:
Der EU-Aktionsplan für den KI-Kontinent: Ein Wendepunkt für die digitale Souveränität (öffnet in neuem Tab)
Digitale Souveränität: Europäische Alternativen für digitale Anwendungen (öffnet in neuem Tab)
Zwischen Innovation und Geschäftsgeheimnis: Wie der Data Act Europas Datenökonomie reformieren will (öffnet in neuem Tab)