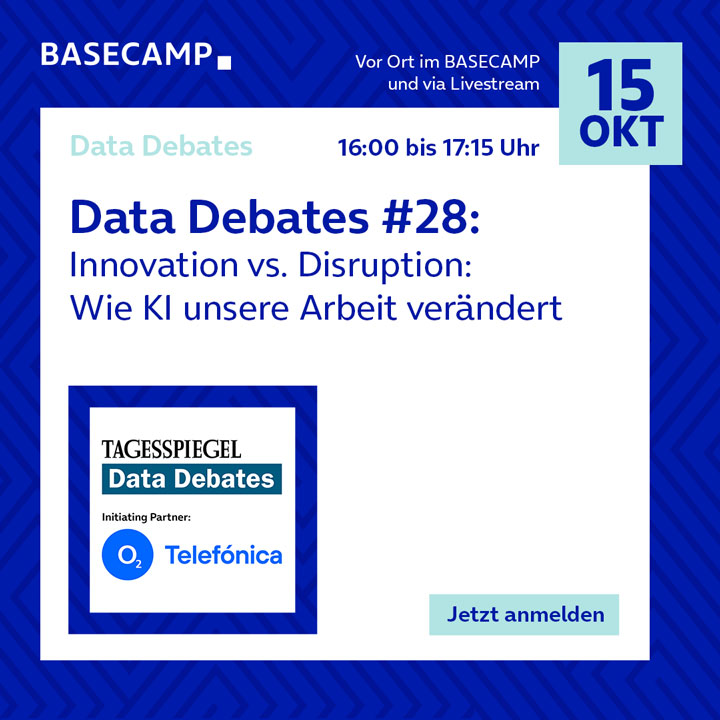DSA, DMA, AI Act: Zwischen ambitionierter Regulierung und praktischen Herausforderungen


Europa macht ernst mit dem digitalen Umbruch: Drei wegweisende Gesetze verändern die Spielregeln für Tech-Konzerne, KI-Entwickler und Online-Plattformen. Der AI Act, der Digital Markets Act (DMA) und der Digital Services Act (DSA) sollen gemeinsam Europas „digitalen Goldstandard“ schaffen. Ein Jahr nach dem “gesetzlichen” Starts zeigt sich jedoch: Zwischen Anspruch und Realität klafft eine Lücke.
Dieser digitale Umbruch entsteht aus dem Zusammenspiel der vielfältigen Maßnahmen, die durch die neuen Regelwerke umgesetzt werden: Der AI Act bringt klare Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz: Systeme werden nach ihrem Risiko bewertet, besonders gefährliche Anwendungen verboten und Anbieter zu Transparenz verpflichtet. Währenddessen nimmt der DMA und die Macht großer Plattformanbieter ins Visier, um faire Wettbewerbsbedingungen und mehr Wahlfreiheit für Nutzer und Nutzerinnen zu schaffen. Ergänzt wird dieses regulatorische Gerüst durch den DSA, der Plattformen strengere Vorgaben für den Umgang mit Inhalten, Desinformation und Transparenz auferlegt. Zusammengenommen entsteht so erstmals ein europäischer Rahmen, der Innovation lenken, Marktmacht begrenzen und Verantwortung im digitalen Raum verbindlich regeln soll. Europa hat sich damit viel vorgenommen: faire Märkte, sichere Plattformen und einen verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Doch während die neuen Regeln bereits Wirkung zeitigen, treten auch Schwächen und Widersprüche zutage:
DSA und DMA – Umsetzungserfolge mit Nebenwirkungen
Der DSA gilt seit Februar 2024 und entfaltet bereits Wirkung. Der Digital Services Coordinator ist innerhalb der Bundesnetzagentur für den DSA zuständig und legte im August 2025 ihren ersten Tätigkeitsbericht (öffnet in neuem Tab) vor. 824 Beschwerden wurden eingereicht – von Impressumspflichten über betrügerische Webseiten bis hin zu Datenschutzverstößen. Vier Verfahren gegen deutsche Anbieter laufen, erste „Trusted Flagger“ wurden zertifiziert, und auch eine außergerichtliche Streitbeilegungsstelle ist aktiv.

Gleichzeitig zeigt sich, dass die Bundesnetzagentur personell unterbesetzt (öffnet in neuem Tab) ist. Ende 2024 standen nur 24 Mitarbeitende zur Verfügung, 38 sind geplant – ursprünglich waren 91 Stellen kalkuliert. Branchenverbände wie eco warnen, dass die Bearbeitung von Beschwerden ins Stocken gerät und Deutschland seine Rolle im europäischen Koordinierungsverbund nicht voll ausfüllen kann.
Auch der Mittelstand kämpft mit der Verordnung: Das Beispiel Gutefrage.net (öffnet in neuem Tab) verdeutlicht, wie stark kleinere Unternehmen belastet werden. 3.500 bis 4.000 Stunden investierte das Team allein in die DSA-Umsetzung. Besonders kritisiert werden die umfangreichen Transparenzberichte und komplizierten Meldeprozesse für Nutzer und Nutzerinnen, die nun Paragrafen statt einfacher Begründungen angeben müssen. Während Tech-Giganten finanziell robust genug sind, die Regulierung als Kostenpunkt einzuplanen, wird der Mittelstand an die Grenzen seiner Ressourcen gebracht.
Neben dem DSA entfaltet auch der DMA Wirkung: Seit März 2024 gilt das Gesetz, und bereits im April 2025 verhängte die EU-Kommission erste Milliardenstrafen (öffnet in neuem Tab). Apple musste 500 Millionen Euro zahlen, Meta 200 Millionen – ein deutliches Signal an die Gatekeeper, dass Wettbewerbsverstöße ernst genommen werden. Unter dem Begriff (öffnet in neuem Tab) „Gatekeeper“ versteht die Europäische Kommission große Technologieunternehmen, die sogenannte „Core Platform Services“ betreiben, etwa Webbrowser, Suchmaschinen, soziale Medien, Betriebssysteme oder Sprachassistenten. Diese Plattformen zeichnen sich durch ihre enorme Reichweite, die Menge an Nutzerdaten und ihren Einfluss auf digitale Märkte aus. Gatekeeper fungieren als zentrale Zugänge für Unternehmen, kontrollieren den Zugang zu populären Diensten und können ihre marktbeherrschende Position nutzen, um Wettbewerb und Innovation zu behindern. Mit ihrer Kontrolle über essentielle digitale Dienste prägen sie maßgeblich die Online-Landschaft und den Erfolg anderer Marktakteure.
Diese strikten Maßnahmen verdeutlichen auch die geopolitische Dimension der europäischen Digitalpolitik. In den USA wird heftig über die EU-Gesetze diskutiert. Meta-Manager Joel Kaplan (öffnet in neuem Tab) bezeichnete die DMA-Strafen gar als „Milliarden-Dollar-Zoll“ auf amerikanische Unternehmen. Gleichzeitig gestaltet sich die Durchsetzung der europäischen Regeln schleppend: Keines der großen DSA-Verfahren gegen Plattformen wie TikTok oder X ist bislang abgeschlossen. So wächst die Kritik, dass Brüssel zwar hohe Ansprüche formuliert, in der praktischen Umsetzung aber hinterherhinkt.
AI Act – ambitioniert, aber stockend
Während DSA und DMA bereits greifen, stolpert (öffnet in neuem Tab) der AI Act besonders in der nationalen Umsetzung. Deutschland hat die EU-Frist zur Benennung nationaler Aufsichtsbehörden im August 2025 verpasst. Verantwortlich dafür war unter anderem die vorgezogene Bundestagswahl, die das Gesetzgebungsverfahren ins Stocken brachte. Deutschland steht jedoch nicht allein: Auch zahlreiche andere Mitgliedstaaten (öffnet in neuem Tab) haben bislang weder Behörden benannt noch Gesetzesentwürfe vorgelegt. Während Länder wie Spanien mit einer zentralen KI-Behörde oder Finnland mit einem dezentralen Modell bereits vorgehen, herrscht in vielen Hauptstädten weiter Stillstand.

In Berlin liegt immerhin ein konkreter Referentenentwurf (öffnet in neuem Tab): Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung hat jüngst das „Gesetz zur Marktüberwachung und Innovationsförderung von künstlicher Intelligenz“ vorgelegt. Es sieht die Bundesnetzagentur als zentrale Aufsichtsstelle vor, die zugleich Marktüberwachung, Informations- und Beschwerdestelle übernimmt. Unterstützt werden soll sie durch ein Netz spezialisierter Behörden wie BSI (IT-Sicherheit) oder BaFin (Finanzsektor). Zusätzlich sind eine unabhängige KI-Marktüberwachungskammer, ein Koordinierungs- und Kompetenzzentrum (KoKIVO) sowie KI-Reallabore geplant, in denen Unternehmen neue Systeme unter realen Bedingungen testen können.
Vor diesem Hintergrund des neuen Gesetzesentwurfs begannen kontroverse Diskussionen: Industrieverbände (öffnet in neuem Tab) warnen vor Überregulierung und verweisen auf internationale Wettbewerbsfähigkeit, während Datenschützer und Zivilgesellschaft (öffnet in neuem Tab) robusten Kontrollmechanismen und transparenten Beschwerden den Vorrang geben. Die Koordination der Aufsichtsbehörden ist noch nicht abschließend geregelt; bis Mitte September können die Ministerien Stellungnahmen abgeben.
Bis zur Verabschiedung herrscht für Unternehmen Rechtsunsicherheit: Ansprechpartner fehlen, während die Pflichten aus der EU-Verordnung bereits gelten. Fachleute warnen vor einem Umsetzungsstau, der nicht nur Deutschland betrifft, sondern die gesamte europäische Regulierung ausbremst. Gleichzeitig wächst die Sorge um die Innovationsfähigkeit Europas. „The US innovates, the EU regulates“, dieses Narrativ (öffnet in neuem Tab), das halb Vorurteil, halb Wahrheit ist, gilt es, zu ändern.
Roadmap für die Quadratur des Kreises
Der europäische Dreiklang aus DSA, DMA und AI Act markiert zweifellos einen historischen Wendepunkt. Noch nie zuvor hat die EU so umfassend versucht, die digitale Wirtschaft zu gestalten. Doch die Realität zeigt: Personalmangel, Bürokratie, internationale Spannungen und Innovationsrisiken bremsen die Wirkung.
Die Herausforderung der kommenden Jahre liegt weniger darin, neue Gesetze und Regulierungen zu verabschieden, sondern ihre Umsetzung entsprechend auszustatten und voranzutreiben. Schafft es Europa, digitale Souveränität zu stärken, ohne Innovation zu ersticken? Gelingt der Spagat zwischen Grundrechtsschutz und Wettbewerbsfähigkeit? Von den Antworten auf diese Fragen hängt ab, ob die europäische Digitalregulierung zum globalen Vorbild wird – oder zur warnenden Fußnote.
Mehr Informationen:
100 Tage neue Bundesregierung: Digitalpolitische Bilanz
Augenhöhe als Anspruch: Was Europa für seine Wettbewerbsfähigkeit tun muss
EU-Ratspräsidentschaft: Dänemarks EU-Agenda für die nächsten sechs Monate