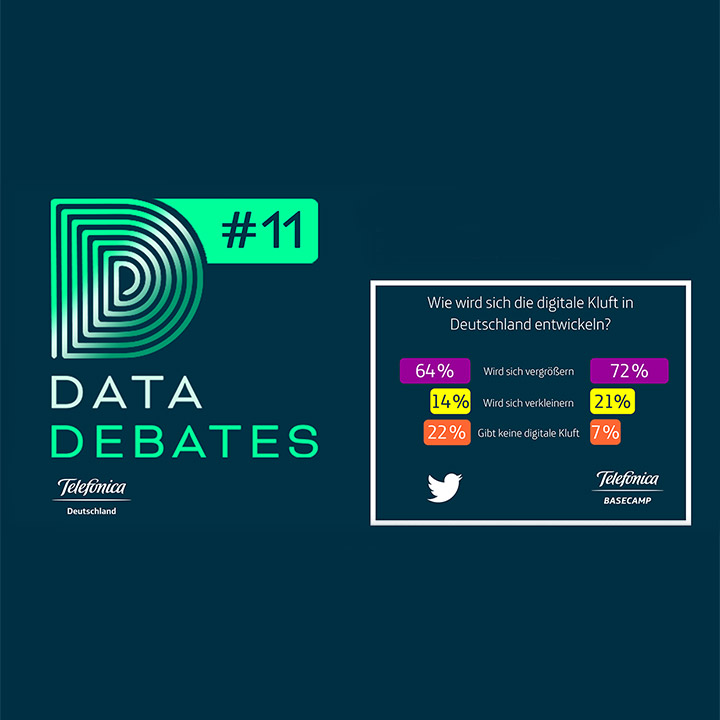Digitalpakt: Referentenentwurf für Grundgesetzänderung

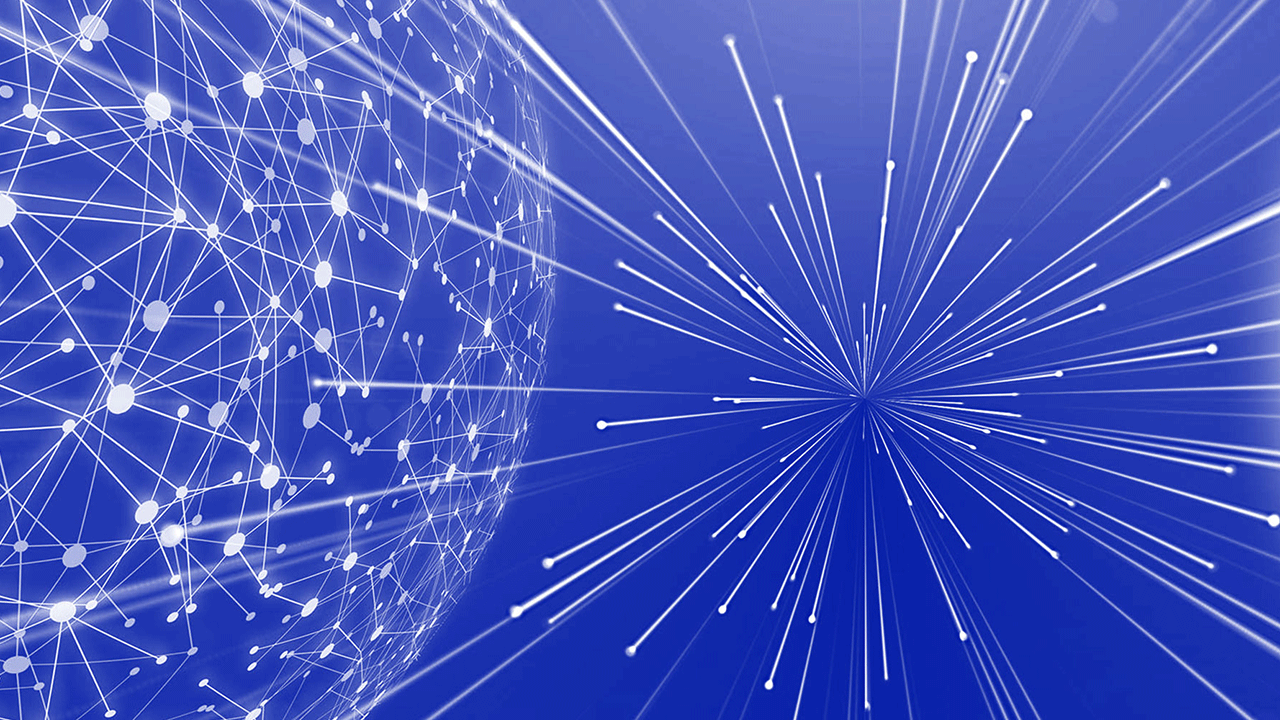

Ein Wort wird gestrichen, zwei werden ergänzt: Mit dieser kleinen Grundgesetzänderung plant die Regierung den Weg für Investitionen des Bundes in Bildungsinfrastruktur freizumachen – und damit auch für den Digitalpakt (öffnet in neuem Tab). Das geht aus einem Referentenentwurf hervor, der dem Tagesspiegel Politikmonitoring (öffnet in neuem Tab) vorliegt. Der Artikel 104c Satz 1 des Grundgesetzes lautet bisher:
„Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der finanzschwachen Gemeinden (Gemeindeverbände) im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren.“
Das Wort „finanzschwach“ soll dem Entwurf zufolge gestrichen und durch die Wörter „Länder und“ ersetzt werden. Dann würde der Satz lauten:
„Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren.“
Nach der Zeitplanung der Bundesregierung (öffnet in neuem Tab) von Mitte April soll die Grundgesetzänderung am 2. Mai auf der Tagesordnung des Kabinetts stehen. In dem Referentenentwurf geht es auch um den sozialen Wohnungsbau und Änderungen an zur Verstetigung der Bundesmittel für den Öffentlichen Personennahverkehr. Der Grundgesetzänderung müssten zwei Drittel des Bundestages und des Bundesrates zustimmen – was der Opposition und den Ländern Verhandlungsspielräume eröffnet.
Auftrag aus dem Koalitionsvertrag
Mit dem Entwurf zur Grundgesetzänderung setzt die Bundesregierung einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag (öffnet in neuem Tab) fast im Wortlaut um. Nach der Rechtsauffassung des Bundesbildungsministeriums (öffnet in neuem Tab) (BMBF) in der vergangenen Legislaturperiode hätte der Digitalpakt auch ohne Grundgesetzänderung zwischen Bund und Ländern vereinbart werden können.
Im Entwurf wird klargestellt, dass es sich bei den Investitionen um Sachinvestitionen handeln muss. Neben dem Neubau und der Sanierung von Gebäuden soll es dabei „um die Errichtung einer bildungsbezogenen digitalen Infrastruktur, wie z.B. die Ausstattung mit schnellen Internetverbindungen und IT-technischen Systemen (Hard- und zugehörige Betriebssoftware) als Teil von pädagogischen Bildungsumgebungen oder gemeinsame Bildungsclouds der Länder für Schulen“ gehen.
Eine oder mehrere Bildungs-Clouds?
Interessant ist der Plural beim Wort „Cloud“. Im Koalitionsvertrag wird der Singular verwendet:
„[…] wollen wir eine gemeinsame Cloud-Lösung für Schulen schaffen“.
Vor allem der jetzige Bundeskanzleramtschef Helge Braun (öffnet in neuem Tab) (CDU) hatte um den Jahreswechsel in Interviews eine bundesweit einheitliche Plattform für alle Länder gefordert. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (öffnet in neuem Tab) (CDU) hatte in einem Interview (öffnet in neuem Tab) mit der Rheinischen Post (RP) im März gesagt, es müsse gelingen die Plattformen zusammenzuführen, die von Ländern schon entwickelt oder konzipiert worden seien.
„Nur dann macht ein Cloud-Projekt Sinn. Dieser Prozess ist sehr aufwendig. Die Cloud ist aktuell ein Pilot, welcher in einigen Schulen schon erprobt wird, und soll spätestens ab 2021 im Regelbetrieb der Schulen nutzbar sein“, so Karliczek.
Das BMBF erklärte gegenüber dem Tagesspiegel Politikmonitoring, dass die Finanzmittel voraussichtlich ab 2019 benötigt werden. Dafür werde man die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen schaffen. Im RP-Interview hatte Karliczek eine Verknüpfung der Mittel für den Digitalpakt mit den Erlösen aus den 5G-Frequenzen hergestellt.
„In die reale Umsetzung können wir erst gehen, wenn der Fonds aus der Versteigerung der 5G-Lizenzen da ist“, so Karliczek.
Allerdings hatten Digitalpolitiker von SPD (öffnet in neuem Tab) und CDU (öffnet in neuem Tab) nach den Koalitionsverhandlungen Zweifel daran geäußert, dass die Mittel aus der Frequenzvergabe auch nur für den Breitbandausbau reichen – und als Erfolg verbucht, dass diese Mittel dafür auch aus dem Haushalt finanziert werden.
Unzufriedene Landesminister
Die Bildungsminister der Länder zeigten sich nach Karliczeks ersten Interviewäußerungen zum Digitalpakt wenig begeistert. Hamburgs Bildungssenator Thies Rabe (öffnet in neuem Tab) (SPD) ist skeptisch, ob bereits im nächsten Jahr Mittel aus dem Digitalpakt fließen, wenn die Bundesregierung zunächst das Grundgesetz ändern wolle.
„Diese neue Zeitplanung bedeutet, dass vor 2020 kein Geld kommt und sich der Digitalpakt letztlich um drei Jahre verzögert“,
zitiert ihn der Bildungsjournalist Jan-Martin Wiarda (öffnet in neuem Tab) in seinem Blog (öffnet in neuem Tab).
Mit besonders deutlicher Kritik meldet sich Karliczeks Parteifreundin, die baden-württembergische Bildungsministerin Susanne Eisenmann (öffnet in neuem Tab) zu Wort:
„Die Lage ist deprimierend. Es gibt vom BMBF keine Terminplanung, es gibt keine Aussage zu der Frage, ob die im vergangenen Jahr vereinbarten Eckpunkte überhaupt weiter gelten.“
Während Eisenmann, die damals Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (öffnet in neuem Tab) (KMK), von „vereinbarten Eckpunkten“ spricht, legt das BMBF Wert darauf, dass es sich lediglich um einen „Entwurf der Eckpunkte“ handelt. Dieser sei eine „tragfähige Grundlage und Richtschnur für die weiteren Verhandlungen“. Es werde sich zeigen, was durch die Grundgesetzänderung modifiziert werden müsse.
Wie stark die Änderungswünsche des Bundes an den Eckpunkten sind, würde auch der jetzige KMK-Vorsitzende (öffnet in neuem Tab), Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (öffnet in neuem Tab) (Linke), gerne erfahren. Gegenüber Wiarda kündigte er an, dass er in der zweiten Maiwoche dazu einen Termin mit Karliczek habe. In der Antwort des BMBF auf die Frage des Politikmonitorings, welche Gespräche mit den Ländern zum Digitalpakt bereits geplant seien, nennt das Ministerium lediglich die nächste KMK-Sitzung am 14. und 15. Juni in Erfurt.
Mit den Reaktionen der Landesminister auf die ersten Ankündigungen des BMBF unter Leitung der neuen Ministerin zeichnet sich ab, dass sich das Gesprächsklima zwischen Bund und Ländern nach der gescheiterten Unterzeichnung der Eckpunkte zum Digitalpakt im Juni 2017 noch nicht wesentlich verbessert hat.
Der vorstehende Artikel erscheint im Rahmen einer Kooperation mit dem Tagesspiegel Politikmonitoring (öffnet in neuem Tab) auf UdL Digital (öffnet in neuem Tab). Sascha Klettke ist Chef vom Dienst und Analyst für Netzpolitik.