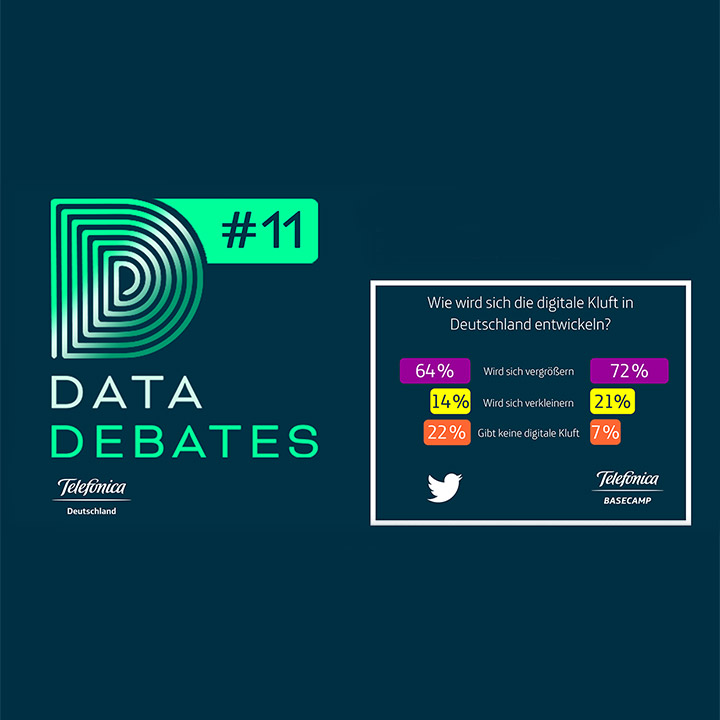Urheberrecht: Neues Gesetz für digitale Wissensgesellschaft

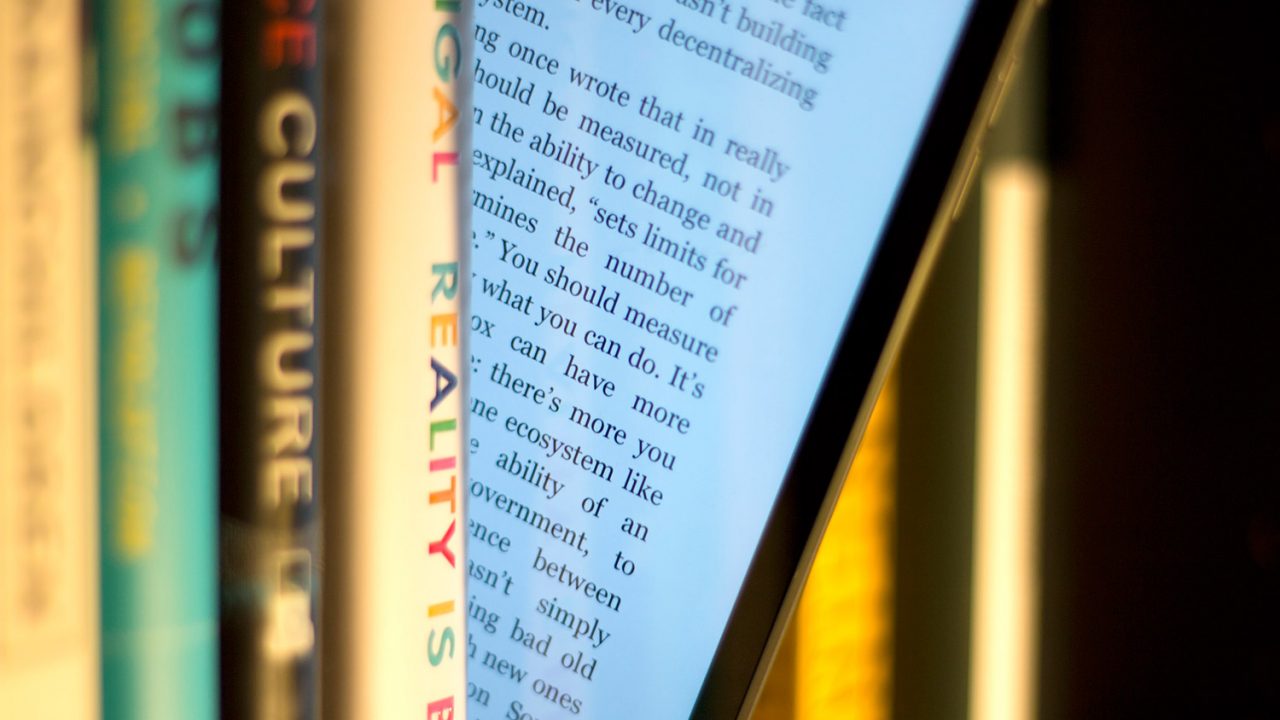
Viele Studierende fürchteten schon, in Zukunft alle Lehrmaterialien analog aus den Bibliotheken heraussuchen zu müssen, anstatt sie wie gewohnt einfach aus den digitalen Semesterapparaten herunterzuladen. Grund dafür waren Streitigkeiten zwischen der Verwertungsgesellschaft VG Wort (öffnet in neuem Tab) und den Hochschulen über die Nutzungsrechte von Werken auf digitalen Lernplattformen. Doch pünktlich zum Semesterstart können die Studierenden aufatmen: Das neue Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (öffnet in neuem Tab) (UrhWissG) hat die Frage des Urheberrechts für Schulen, Universitäten, Bibliotheken und anderen Bildungseinrichtungen klar geregelt. Das Gesetz ist am 1. März in Kraft getreten.
E-Book und YouTube-Vorlesung

Als übergeordnetes Ziel galt, das Gesetz an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft anzugleichen – denn auch diese verändern sich durch die Digitalisierung rasant. Während man sein Wissen vor 25 Jahren noch aus analogen Büchern bezog und bei Vorlesungen anwesend sein musste, um den Stoff zu lernen, bietet das Internet die Möglichkeit, zu jeder Zeit und an jedem Ort an Wissen zu gelangen. Viele Bücher stehen mittlerweile als E-Book zur Verfügung und es gibt Professoren, die ihre Vorlesungen in Online-Portalen hochladen. Vorreiter im E-Learning ist der Linguistik-Professor Jürgen Handke (öffnet in neuem Tab) von der Universität Marburg (öffnet in neuem Tab). Sein You-Tube-Kanal „The Virtual Linguistics Campus“ (öffnet in neuem Tab), auf dem Handke seine Vorlesungen hochlädt, zählt inzwischen über 45.000 Abonennten aus aller Welt. 2015 wurde er dafür sogar mit dem „Ars legendi-Preis für exzellente Hochschullehre“ (öffnet in neuem Tab) vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (öffnet in neuem Tab) und der Hochschulrektorenkonferenz (öffnet in neuem Tab) ausgezeichnet.
Schranken des Urheberrechts
Wichtigster Bestandteil der Novelle, die den Veränderungen in der Wissensgesellschaft Rechnung tragen soll, sind die so genannten Schranken des Urheberrechts. Das sind Ausnahmeregelungen, die es Schulen, Universitäten und Bibliotheken erlauben, urheberrechtlich geschützte Texte, Bilder und Filme zu benutzen, ohne dafür eine Erlaubnis einholen zu müssen. Diese Regelung betrifft vor allem digitale Semesterapparate. Dort dürfen die Dozierenden nun ohne Lizenz die Literatur für alle Teilnehmenden eines Seminars oder einer Vorlesung zur Verfügung stellen. Anstatt die digitalen Nutzungen von Werken mit den Verlagen einzeln abzurechnen sind nun Pauschalvergütungen der Hochschulen ausreichend.
Beschränkt wurde mit der Novelle allerdings die Möglichkeit, ganze Artikel aus Zeitungen zu benutzen, zum Beispiel als Scan auf einer Lernplattform. Genauso wie bei langen Werken gilt für Presseartikel, dass lediglich 15 Prozent davon hochgeladen werden dürfen. Eine Übersicht zu den Befugnissen der Lehrenden bei digitalen Lernplattformen hat die TU Darmstadt in einem Cheat-Sheet (öffnet in neuem Tab) zusammengestellt.
Text- und Datamining
Eine weitere Erleichterung bringt das Gesetz für Text- und Datamining, also der computergestützten Auswertung großer Datenbestände. Eine Schrankenregelung ermöglicht nun eine Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Datenbeständen, die vor der Analyse stattfinden. Forscher dürfen nun ohne Erlaubnis die Inhalte von Datenbanken auslesen und daraus eine eigene Datenbasis erstellen. Benjamin Raue (öffnet in neuem Tab), Professor für Zivilrecht, Recht der Informationsgesellschaft und des geistigen Eigentums an der Uni Trier (öffnet in neuem Tab) hält die Regelung für richtig. „Informationen zu gewinnen, Zusammenhänge zu finden ist keine Tätigkeit, für die das Urheberrecht ein exklusives Verfügungsrecht vorsieht“, erläutert er.
„Der Ansatz der Schrankenregelung entspricht der Forderung aus der Wissenschaft, nach der das ‘Right to Read’ auch das ‘Right to Mine’ umfassen muss“, so Raue weiter.