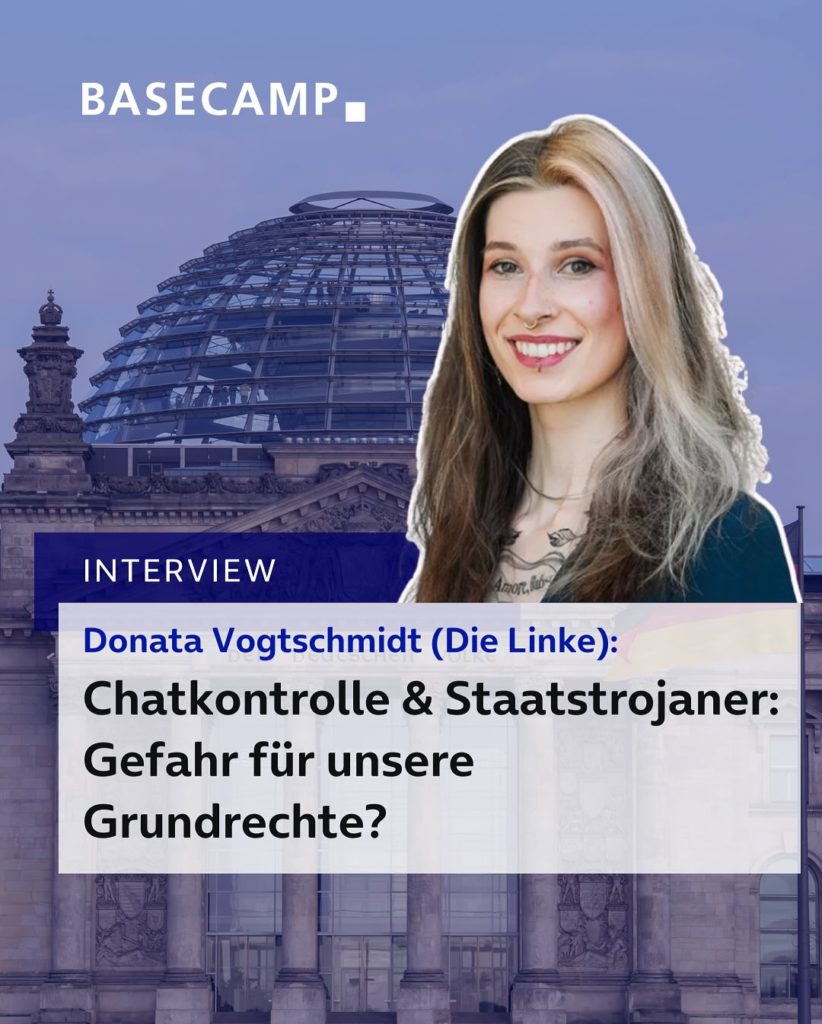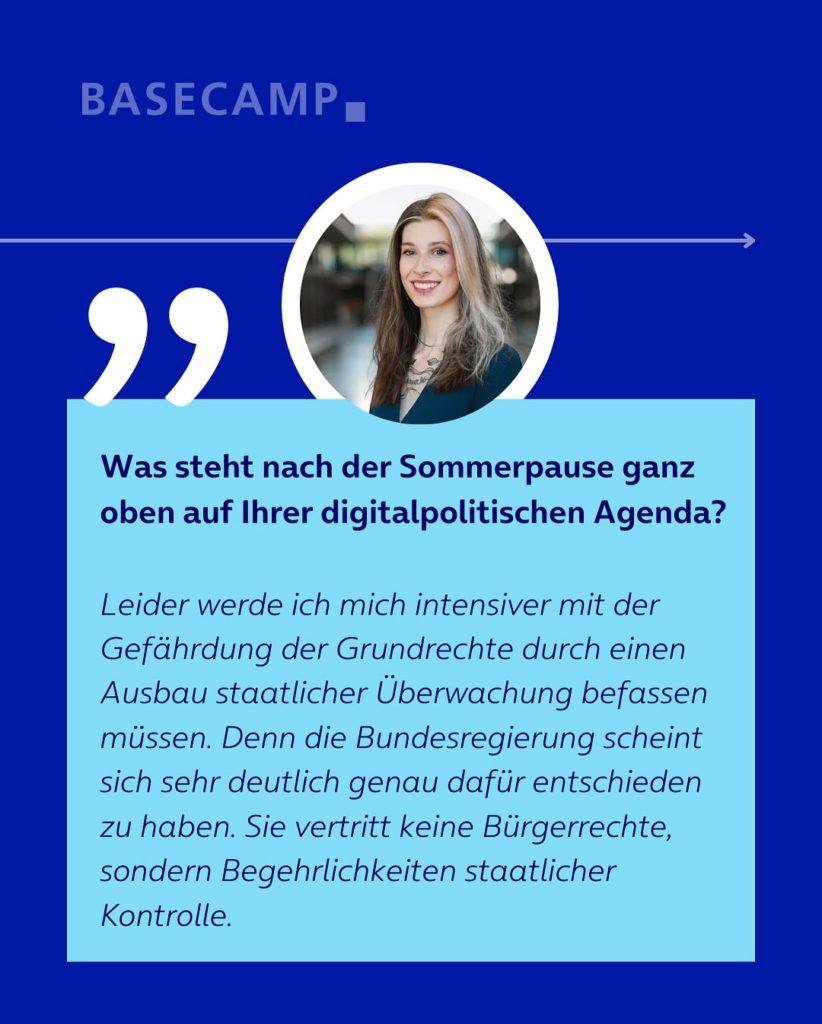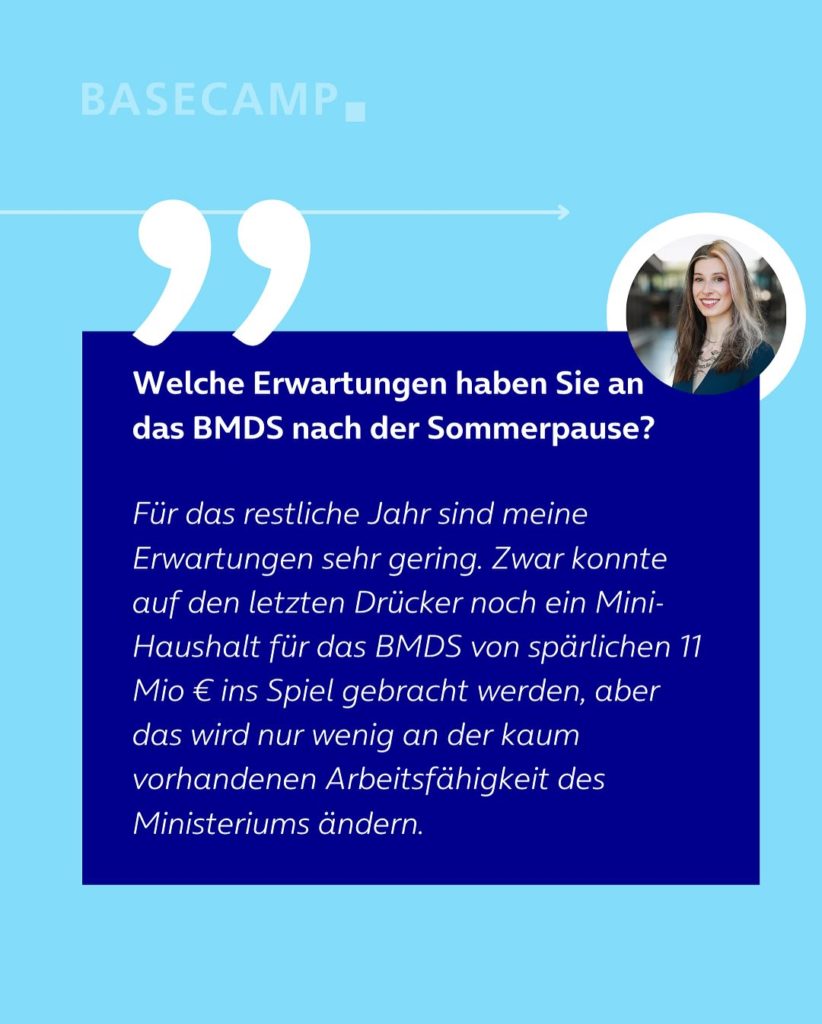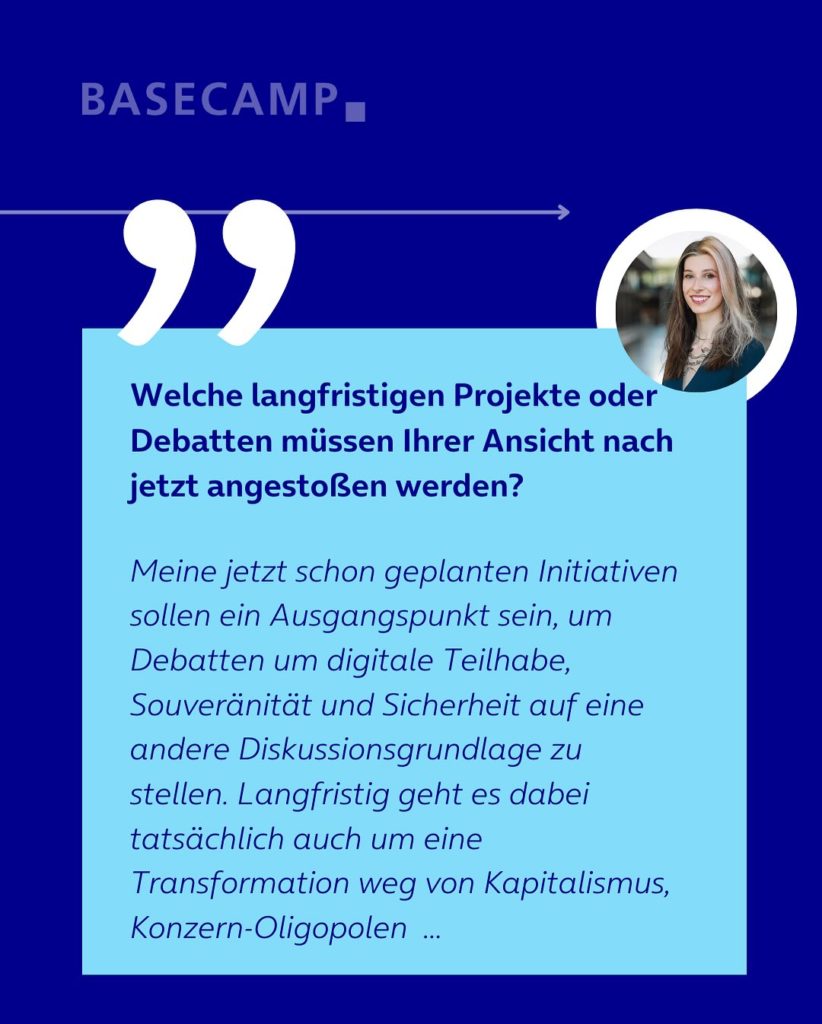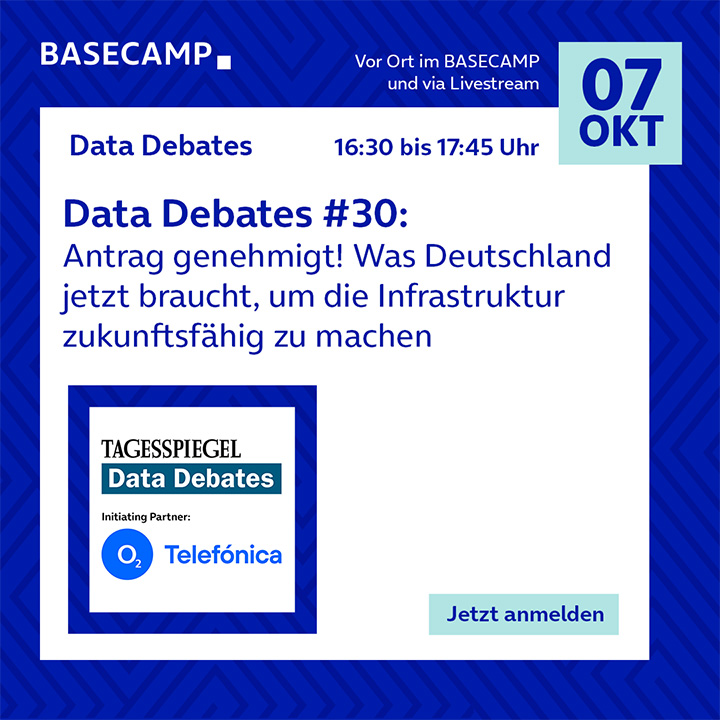Interviewserie: Digitalpolitik back at work mit Donata Vogtschmidt (Die Linke)


Zum Auftakt nach der Sommerpause steht im Bundestag zunächst der Haushalt im Mittelpunkt und damit auch die Frage, welche Mittel das neu gegründete Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) erhält. Doch nicht nur die Finanzen sind entscheidend, die Fraktionen streiten auch inhaltlich darüber, welchen digitalpolitischen Kurs Deutschland in den kommenden Monaten einschlagen soll. In unserer Interviewserie „Digitalpolitik back at work“ kommen die digitalpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Bundestagsfraktionen zu Wort und schildern, wie sie die Lage bewerten und welche Schwerpunkte sie setzen wollen.
Heute sprechen wir mit Donata Vogtschmidt (öffnet in neuem Tab) (Die Linke), die jüngst beim FishBowl zur Frage “Digitalpolitik bis 2029 – was wird anders?” teilnahm. Im Interview blickt sie besonders kritisch auf den Ausbau staatlicher Überwachung und die Gefährdung von Grundrechten – vom Staatstrojaner über Chatkontrolle bis zu den Risiken durch die digitale Werbeindustrie. Vogtschmidt fordert ein neues Problembewusstsein für die Manipulation durch digitale Werbung, den Schutz der IT-Sicherheit sowie eine stärkere dezentrale Infrastruktur und Teilhabe im digitalen Raum:
Alle Beiträge der Serie „Digitalpolitik back at work“:
Digitalpolitik back at work mit Franziska Hoppermann (CDU)
Digitalpolitik back at work mit Johannes Schätzl (SPD)
Digitalpolitik back at work mit Jeanne Dillschneider (Grüne) (öffnet in neuem Tab)
Was steht nach der Sommerpause ganz oben auf Ihrer digitalpolitischen Agenda?
Leider werde ich mich intensiver mit der Gefährdung der Grundrechte durch einen Ausbau staatlicher Überwachung befassen müssen. Denn die Bundesregierung scheint sich sehr deutlich genau dafür entschieden zu haben. Sie vertritt keine Bürgerrechte, sondern Begehrlichkeiten staatlicher Kontrolle. Es betrifft die Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner, die unkritische Haltung zu Chatkontrolle und Protect-EU, sowie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Zusammenführung von Datenbanken, die eigentlich nicht zusammengeführt werden dürfen – Stichwort Palantir. Aber damit nicht genug, auch zwielichtige Geschäfte der Werbeindustrie scheinen für bestimmte Behörden eine willkommene Informationsquelle zu sein. Überhaupt möchte ich noch in diesem Jahr dazu beitragen, dass ein größeres Problembewusstsein dafür entsteht, was die digitale Werbeindustrie für einen Schaden anrichtet – sie manipuliert subtil die Meinung der Menschen, sie steigert unnötig den Energieverbrauch, sie öffnet Sicherheitslücken in allen erdenklichen Apps, und sie verhindert dezentrale Online-Plattformen im Gemeinwohl, die wir so dringend brauchen. Dafür setze ich mich ein.
Hier kann auf vielen Ebenen geholfen werden, beispielsweise mit einer Digitalsteuer auf große kommerzielle Plattformen. Und ich werde mich wo es nur geht zur Wehr setzen, wenn die Trump-Administration und auf Linie gebrachte US-Konzerne wieder einmal EU-Recht attackieren, um Grundrechte auszuhöhlen und Profite zu maximieren. Das hat auch mit IT-Sicherheit zu tun: Wir sollten endlich raus aus der Schlinge des US-CLOUD-Acts und anderer US-Regelungen, die die IT-Sicherheit in Europa gefährden. Aber wir müssen auch weg vom heimlichen Offenhalten von IT-Schwachstellen für Geheimdienste. Das Thema spielt auch bei der jetzt anstehenden Umsetzung der NIS-2-Richtlinie eine Rolle. Hierbei fordere ich statt der geplanten Minimalumsetzung der Bundesregierung umfassende IT-Sicherheit als Priorität, mit den entsprechenden Haushaltsmitteln versehen – aber die werden ja bekanntlich für ein ganz anderes, aus meiner Sicht zweifelhaftes Verständnis von Sicherheitspolitik ausgegeben! Dabei spielt resiliente zivile Infrastruktur eine ganz entscheidende Rolle im Schutz vor Cyberangriffen, beispielsweise aus Russland, sei es für die kommunale Verwaltung, das Krankenhaus oder das Datenkabel in der Ostsee. Mit solchen hybriden Bedrohungen beschäftige ich mich übrigens auch im Verteidigungsausschuss, dem ich neben dem Digitalausschuss angehöre.
Tipp der Redaktion:
BASECAMP FishBowl „Spitzenrunde Digitalpolitik bis 2029 – was wird anders?“ mit Donata Vogtschmidt und weiteren Gästen. Jetzt auf YouTube anschauen.
Welche Erwartungen haben Sie an das BMDS nach der Sommerpause?
Für das restliche Jahr sind meine Erwartungen sehr gering. Zwar konnte auf den letzten Drücker noch ein Mini-Haushalt für das BMDS von spärlichen 11 Mio € ins Spiel gebracht werden, aber das wird nur wenig an der kaum vorhandenen Arbeitsfähigkeit des Ministeriums ändern. Dafür sind auch zu viele Zuständigkeiten noch immer ungeklärt. Für das BSI hätte ich mir gewünscht, dass es dem neuen Ministerium unterstellt wird, aber das bleibt nun wohl Wunschdenken. Zusammen mit einer überarbeiteten Aufgabenbeschreibung mit absolutem Fokus auf IT-Sicherheit hätte damit der langjährige Konflikt aufgelöst werden können, der durch Kollision mit Interessen von Sicherheitsbehörden bestanden hat und weiter besteht.
Welche langfristigen Projekte oder Debatten müssen Ihrer Ansicht nach jetzt angestoßen werden, um Deutschland zukunftsfähig zu machen?
Meine jetzt schon geplanten Initiativen sollen ein Ausgangspunkt sein, um Debatten um digitale Teilhabe, Souveränität und Sicherheit auf eine andere Diskussionsgrundlage zu stellen, die zu wirklich vorteilhaften Veränderungen in diesem Sinne führt. Langfristig geht es dabei tatsächlich auch um eine Transformation weg von Kapitalismus, Konzern-Oligopolen und scheinbar informierte Einwilligungen in den Verkauf der Privatsphäre. Damit meine ich ein paar Mindeststandards, über die wir endlich ernsthaft reden sollten: Offene Daten nützen – Private Daten schützen, Open-Source-Software, Open Hardware, unabhängige Informationsplattformen und Suchmaschinen statt Werbeindustrie, und digitale Teilhabe durch dezentral organisierte Netzwerke und digitale Commons, die von niemandem privat besessen, gekauft oder verkauft werden können. Dann könnte auch KI gesund wachsen, anstatt sich in Investitionsblasen des Wettrüstens heißzulaufen – wofür sogar das Verfeuern fossiler Brennstoffe wieder in Mode gekommen ist – absurd! Auch beim Sicherheitsbegriff muss jetzt ein neues Framing diskutiert werden, um Grundlagen für wirkliche Sicherheit zu schaffen.

Waffen, verdeckte IT-Schwachstellen, nur an maximaler Reichweite von Werbung interessierte Onlineplattformen und das von Dobrindt favorisierte Cyberdome bringen uns absolut nicht weiter. Würde der zivilen IT-Sicherheit jene Aufmerksamkeit geschenkt, die Aufrüstung derzeit innehat, stünden wir schon bald ganz anders und wirklich zukunftsfähig da. Ich möchte auch betonen, dass man nicht alles gleichzeitig haben kann: Arbeitet der IT-Spezialist und die IT-Spezialistin in einer Militärbasis, oder schützt sie das örtliche Krankenhaus – das ist doch die Frage!
Welche Bedeutung hat eine gute Digitalpolitik für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat?
Die Bedeutung ist nicht groß genug einzuschätzen. Es beginnt bei der Netzinfrastruktur: Seit etwa 30 Jahren sind in Deutschland Handys verbreitet, ähnliche lange schon das Internet. Ein großer Teil des öffentlichen Lebens spielt sich inzwischen darüber ab. Dass Millionen Menschen anno 2025 immer noch schwaches oder teilweise sogar fehlendes Netz haben, führt ganz zurecht zu massivem Vertrauensverlust in den Staat insgesamt. Ähnlich ist es bei den digitalen Bürgerservices, hier gelingt es seit etlichen Jahren einfach nicht, gute und funktionale Dienste zu schaffen, die Prozesse einfacher und vor allem auch schneller machen. Fehlanzeige!

Vertrauen geht aber auch verloren, wenn Menschen ständig von erfolgreichen Cyberangriffen erfahren, die durchaus mal ganze Städte oder auch Krankenhäuser aus der Spur bringen und das berechtigte Gefühl aufkommen lassen, dass die Privatsphäre nicht mehr sicher ist. Sie verlieren auch Vertrauen in den Staat, wenn das Netz von Deepfakes und Desinformation geflutet wird, beispielsweise weil ein Elon Musk seine libertären Träume nicht nur persönlich äußert, sondern eine riesige Online-Plattform steuern kann. Gute Digitalpolitik war bisher also Mangelware. Und ein großer Teil des allgemeinen Vertrauensverlustes in staatliche Institutionen hängt sicherlich unmittelbar damit zusammen. Entscheidend ist, dass es falsch wäre, mit Abschottung oder Repression darauf zu reagieren. Stattdessen müssen auch in der Digitalpolitik endlich jene akuten Baustellen mit Priorität angegangen werden, die den Vertrauensverlust verursacht haben.
Woran wird sich der Bundesdigitalminister am Ende der Legislatur messen lassen müssen?
Gemessen am Koalitionsvertrag hängt die Messlatte leider nicht allzu hoch, von einer schwarz-rot geführten Digitalpolitik erwarte ich keine hilfreichen Impulse. Anders als die Ampel-Regierung, hat man sich für diese Wahlperiode nur wenig vorgenommen. Im besten Fall geht es mit der Registermodernisierung und der digitalen Identität ein gutes Stück voran. Damit rechne ich aber nur deshalb, weil es EU-Verordnungen gibt, die die Bundesregierung dazu zwingen, hier Ergebnisse zu liefern. Vielleicht werden auch Fortschritte im Schutz vor digitaler Gewalt insbesondere auch gegen Frauen erreicht, hier öffnet der Koalitionsvertrag immerhin ein Möglichkeitsfenster. Ob es Herrn Wildberger gelingt, mehr von der versprochenen digitalen Souveränität zu erreichen, bezweifle ich. Aussichtsreiche Maßnahmen zu einer Loslösung von Abhängigkeiten aus Nicht-EU-Staaten kann ich nicht erkennen. Das spiegelt sich beispielsweise auch im Haushalt bei der stiefmütterlichen Behandlung des Zentrums für Digitale Souveränität wider. Bei vielen Zielen hoffe ich, dass Wildberger sie auch gar nicht erreicht, beispielsweise eine Abschwächung von Datenschutzstandards für noch mehr Nutzung persönlicher Daten durch Wirtschaft und Sicherheitsbehörden. Ich selbst werde ihn auch daran messen, ob es ihm gelingt, Politik frei von Interessenkonflikten aus seiner privatwirtschaftlichen Vergangenheit und gehaltenen Aktien zu gestalten. Erste Hinweise darauf werden wir schon bald beim Umgang mit den 6-GHz-Frequenzen und dem bevorstehenden Verkauf von Media Markt/Saturn an JD.com sehen.
Mehr Informationen:
Interviewserie: Digitalpolitik back at work mit Franziska Hoppermann (CDU)
100 Tage neue Bundesregierung: Digitalpolitische Bilanz
Die Bundesregierung im Urlaub: 16 Mal Out of Office