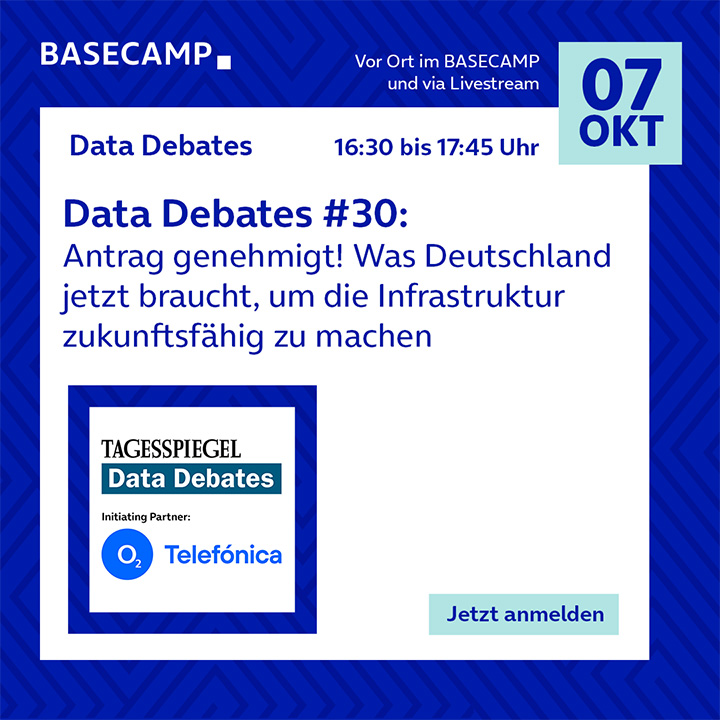Im Digital-Check: Das Merz-Kabinett
Die neue Bundesregierung von Friedrich Merz (CDU) hat der Digitalisierung mit dem neuen Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung (BMDS) eine Heimstätte gegeben. Doch Digitalpolitik ist und bleibt ein ressortübergreifendes Querschnittsthema. Wir schauen auf das Digitalprofil des neuen Kabinetts.
Bereits der Koalitionsvertrag hat klargestellt, dass Digitalisierung zentrale Ziele wie Souveränität, Innovationsfähigkeit und gesellschaftlichen Fortschritt fördern soll. Der direkt nach der Kanzlerwahl ergangene Organisationserlass buchstabiert diesen Ansatz weiter aus und verschiebt viele Kompetenzen zum neuen Digitalministerium. Gleichzeitig bleiben Schlüsselbereiche wie z.B. Teile der Netzsicherheit oder Technologieentwicklung weiterhin bei Innen- bzw. Forschungsministerium angesiedelt. Nachfolgend werfen wir einen Blick darauf, wie gut das neue Kabinett (öffnet in neuem Tab) unter Kanzler Merz digitalpolitisch aufgestellt ist – und welche Minister:innen welche Rollen in der digitalen Transformation übernehmen könnten.
Friedrich Merz: Kanzler mit Digitalisierungswillen
Der Kanzler selbst steht hinter dem Projekt, die Digitalisierung in Deutschland endlich ins Laufen zu bringen, ist aber kein ausgewiesener Digitalexperte. Die Entscheidung für ein eigenständiges Digitalministerium und die nicht unriskante Ernennung eines politikfremden und parteilosen Managers als Minister in Person von Karsten Wildberger, war für viele überraschend und zeigt: Für diese Mammutaufgabe setzt Merz auf praktische Erfahrung statt Parteikarriere.
Klicken zum Vergrößern
Karsten Wildberger: Deutschlands erster Digitalminister
Mit Karsten Wildberger übernimmt nun ein promovierter Physiker und Wirtschaftsexperte das neu geschaffene Digitalministerium. Als Vorstandsvorsitzender verschiedenere Unternehmen hat er große Transformationsprojekte verantwortet und gilt als ausgewiesener Digitalisierungsexperte. Zwar fehlt ihm die politische Erfahrung, doch seine Managementkompetenz und sein frischer Blick könnten dem Ministerium entscheidende Impulse geben.
Der Erfolg seines neuen Amtes wird wesentlich von drei Faktoren abhängen: Erstens steht die Frage im Raum, wie stabil die Rückendeckung durch Kanzler und Kabinett für seine ambitionierten Transformationspläne im Laufe der Zeit sein wird. Zweitens kommt es darauf an, ob seine konkreten Zuständigkeiten und seine Steuerungskraft bei ressortübergreifenden Digitalprojekten ausreichen. Und drittens, davon, ob es ihm gelingt, als Minister Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft zu überzeugen – und ihre Perspektiven konstruktiv in seine Arbeit einzubinden.
Bei den ersten beiden Punkten ist Wildberger gut aufgestellt. Insbesondere mit dem Zustimmungsvorbehalt für IT-Ausgaben deutet der Organisationserlass an, dass das BMDS mehr als Symbolpolitik ist. Wie Wildberger es schafft, Aufbruchstimmung für die digitale Transformation in Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft zu verankern, wird die entscheidende Frage sein.
Lars Klingbeil: Vom Netzpolitiker zum obersten Kassenwart
Als Finanzminister und Vizekanzler übernimmt Lars Klingbeil eine Schlüsselrolle in der neuen Regierung. Der SPD-Politiker kann auf umfangreiche digitalpolitische Erfahrung zurückblicken – bis 2021 war er im Ausschuss Digitale Agenda aktiv. Digitalpolitik gehört nicht nur aufgrund seiner Mitgliedschaft beim digitalpolitischen Thinktank D64 zu einem seiner Steckenpferde (öffnet in neuem Tab).
Klingbeil hat betont, dass Digitalisierung nicht nur eine technische, sondern vor allem eine gesellschaftliche (öffnet in neuem Tab) Transformation sei. Diese Perspektive dürfte seine Prioritäten auch als Kassenwart beeinflussen. Die Kompetenzen für Digitalisierung liegen zwar klar beim BMDS, doch die Transformationspolitik wechselt vom Kanzleramt ins Finanzministerium – sodass sich sein Herzensthema zumindest in Teilen auch in seiner neuen Aufgabe widerspiegeln dürfte und er seine digitalpolitischen Fertigkeiten beweisen kann.
Alexander Dobrindt: Innenminister mit Digitalerfahrung
Alexander Dobrindt, Innenminister, war bereits unter Angela Merkel in Digitalfragen aktiv und Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Dabei war er auch an der Digitalen Agenda beteiligt. Die Bilanz (öffnet in neuem Tab) zu dieser blieb damals gemischt: Die Zuständigkeiten waren zwischen den drei zuständigen Ministerien (Verkehr, Innen und Wirtschaft) zersplittert und Fortschritte eher schleppend.
Beweisen muss sich Dobrindt in der neuen Legislaturperiode im Bereich Digitales eher weniger, denn sein neues Haus ist jenes, was am meisten Kompetenz an das neu gegründete BMDS abgibt: Zentrale Digitalthemen wie IT-Infrastruktur und Verwaltungsdigitalisierung verlassen das BMI.
Katherina Reiche: Politik-Comebackerin mit Wirtschaftserfahrung
Katherina Reiche übernimmt ein zentrales, aber thematisch stark beschnittenes Wirtschaftsministerium. Zwar wandern einige digitalpolitische Zuständigkeiten – wie die nationale Digitalpolitik und der Digitalgipfel – an das BMDS, doch das BMWE bleibt ein Schlüsselakteur: Ohne stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen wird die digitale Transformation nicht gelingen. Reiche bringt dafür vielfältige Erfahrung mit.
Von 2013 bis 2015 war sie Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (zuvor weitere vier Jahre im BMU) – eine Zeit, die zwar nicht für großen digitalen Aufbruch steht, ihr jedoch ein Verständnis für komplexe Verwaltungs- und Transformationsprozesse vermittelt haben.
Dorothee Bär: Neue Chance für die frühere Digitalstaatsministerin
Mit Dorothee Bär übernimmt die ehemalige Digitalstaatsministerin das Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Bär war von Dezember 2013 bis März 2018 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur und dann die erste und bisher einzige Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung von 2018 – 2021. In ihrer Zeit als Staatsministerin fiel die Bilanz wenig überzeugend aus. Trotz großer Ankündigungen blieben viele digitale Projekte in den Kinderschuhen stecken. Dies lag nicht zuletzt am begrenzten Handlungsspielraum für den im Bundeskanzleramt angesiedelten Posten.
In ihrer neuen Rolle ist Bär nun für Grundsatzfragen der nationalen und internationalen Innovations- und Technologiepolitik zuständig, ebenso wie für die Entwicklung digitaler Schlüsseltechnologien. Ihre politische Erfahrung und ihr öffentliches Profil könnten ihr hier zugutekommen – ebenso wie ihr Engagement außerhalb der Ministerien: Als Schirmherrin des gemeinnützigen Vereins für Digitale Empathie, der sich gegen Cyber-Mobbing einsetzt, positioniert sie sich auch in gesellschaftspolitisch sensiblen digitalen Themenfeldern.
Boris Pistorius: Digitale Transformation der Bundeswehr
Als einziger Minister, der aus dem vorherigen Kabinett übernommen wurde, setzt Boris Pistorius seine Arbeit als Verteidigungsminister fort. Laut Koalitionsvertrag soll die Bundeswehr digitaler, einsatzfähiger und attraktiver werden. Eine entscheidene Rolle könnte dabei der Cyber Innovation Hub spielen.
Auch Pistorius ist nicht gerade als profilierter Digitalpolitiker bekannt. Sowohl als ehemaliger niedersächsischer Innenminister als auch durch seine erste Amtszeit im Bendlerblock haben ihn näher Digitalthemen wie Cybersicherheit, hybride Bedrohungen und Datenschutz geführt. Im Gegensatz zu anderen Minister:innen hat Pistorius zudem freie Hand in seinen IT-Ausgaben, da der Zustimmungsvorbehalt des Digitalministeriums für sein Haus nicht gilt.
Frischer Wind für Bau und Justiz:
Mit der ehemaligen Unternehmerin Verena Hubertz kommt digitale Gründungserfahrung ins Bauministerium. Die 37-jährige SPD-Politikerin gründete vor ihrer politischen Karriere erfolgreich „Kitchen Stories“. Mit ihrem Start-up hat Hubertz eine der erfolgreichsten deutschen Food-Tech-Plattformen aufgebaut und kennt die Herausforderungen digitaler Geschäftsmodelle aus erster Hand. Ihr unternehmerisches Denken und ihre digitale Selbstverständlichkeit dürften im Bauministerium wichtige Impulse setzen.

Das Justiz- und Verbraucherschutzministerium übernimmt mit Stefanie Hubig eine erfahrene Juristin. Bei digitalen Themen verantwortet Hubig dann künftig insbesondere den Schutz im digitalen Raum bei Online-Handel, digitalen Waren und Dienstleistungen sowie die Durchsetzung von Verbraucherrechten und das Verbraucherinformationsgesetz. Für diese Themen werden jedoch voraussichtlich primär ihre juristischen Fähigkeiten in den Vordergrund rücken.
Und die anderen?
Der Großteil der Minister:innen fällt nicht durch besondere digitalpolitische Expertise auf. Ganz entziehen können sie sich dem Thema dennoch nicht, zu sehr greift Digitalisierung inzwischen in nahezu alle Politikfelder ein. Nina Warken etwa wird sich im Gesundheitsministerium vorrangig um Sicherheit, Verlässlichkeit und Funktionsfähigkeit der elektronischen Patientenakte kümmern müssen. Digitale Zuverlässigkeit dürfte für sie weniger Kür als Pflicht sein. Der neue Verkehrsminister Patrick Schnieder wiederum könnte fast erleichtert sein, dass Digitales nicht (mehr) zu seinem Zuständigkeitsbereich zählt – sein Fokus liegt nun auf dem Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen. Und was beispielsweise Carsten Schneider im Umweltministerium digitalpolitisch vorhat, bleibt vorerst offen. Zwar gäbe es große Potenziale im Zusammenspiel von Digitalisierung und Klimapolitik, jedoch findet im Koalitionsvertrag dieser Zusammenhang kaum statt.
Das neue Bundeskabinett ist in Summe somit zwar nicht auffallend digitalaffin oder -profiliert, hat aber mit dem breit aufgestellten BMDS und dem klar adressierten politischen Willen gute Chancen, für einen echten Digitalisierungsschub zu sorgen. Entscheidend wird sein, ob die neuen Kompetenzen auch in konkrete Fortschritte und spürbare Modernisierung umgesetzt werden können.
Mehr Informationen:
Neue Macht für die Digitalisierung: Wildbergers Ministerium im Überblick
Neue Bundesregierung: Digitalpolitik und Telekommunikation im Koalitionsvertrag