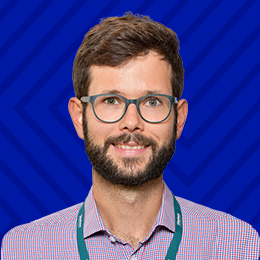Bekämpfung von Fake News: EU geht neue Wege


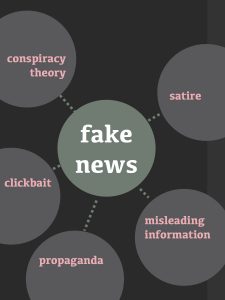
Bildname: Fake News / Ausschnitt bearbeitet
„Fake News ist eine Krankheit“
Eröffnet wurde die „Multi-Stakeholder Conference on Fake News“ von Mariya Gabriel (öffnet in neuem Tab). Die Kommissarin für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft (öffnet in neuem Tab) war im Mai von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (öffnet in neuem Tab) damit beauftragt worden auszuloten, welche Herausforderungen Online-Plattformen im Hinblick auf Fake News an unsere Demokratie stellen und welche Maßnahmen auf europäischer Ebene notwendig wären, um die Bürger der Europäischen Union vor ihnen zu schützen. Auch das EU-Parlament wirkte in dieser Richtung auf die Kommission ein. So forderte es die Kommission im Juni in einem Beschluss (öffnet in neuem Tab) dazu auf, die Rahmenbedingungen von Fake News zu analysieren sowie die Möglichkeiten legislativer Bekämpfung zu überprüfen.
Gesagt – getan. In der Eröffnungsrede (öffnet in neuem Tab) verkündete EU-Kommissarin Gabriel den sofortigen Start einer öffentlichen Konsultation (öffnet in neuem Tab) sowie die Einrichtung einer „High-Level Group on Fake News (öffnet in neuem Tab)“, die im Januar 2018 ihre Arbeit aufnehmen und die Kommissarin in Fragen zum Umgang mit Fake News beraten soll.
„It is vital that we vaccinate our society against this disease so as to maintain our democratic values and strengthen them”, sagte Gabriel bei der Konferenz.
In ihrer Rede nahm die Kommissarin auch Bezug auf Berichte, aus denen hervorgeht, dass Social-Media-Unternehmen Tausende Euros dafür akzeptiert hätten, bestimmte politische Kampagnen in sozialen Medien zu stärken. Dieses Phänomen
„makes it possible for external actors to influence opinion in our democracies to an extent that was never before possible”, so die Kommissarin weiter.
Alle Bürger, Social-Media-Plattformen, Nachrichtenagenturen, Forscher sowie öffentliche Behörden sind dazu eingeladen, ihre Sichtweisen und Kenntnisse zu Fake News in der öffentlichen Konsultation einzureichen, die bis Mitte Februar 2018 läuft. Eine Frage lautet z.B., ob Online-Plattformen ihre Nutzer darüber informieren sollten, wenn ein Roboter einen bestimmten Post erschaffen hat. An anderer Stelle wird gefragt, ob Online-Plattformen ihre Nutzer über die Algorithmen, die verwendet werden und die darüber bestimmen, welche Inhalte den Nutzern angezeigt werden, aufklären sollten.
Aktuelle Gesetzeslage
In Deutschland ist man in diesem Jahr bereits gesetzlich gegen die Verbreitung von illegalen Inhalten, wie z.B. Hasskommentaren, vorgegangen. Das Justizminister Heiko Maas (öffnet in neuem Tab) ins Leben gerufene Netzwerkdurchsetzungsgesetz (öffnet in neuem Tab) ist seit dem ersten Oktober in Kraft. In dem Gesetz heißt es, dass „offensichtlich rechtswidrige Verstöße“ von den sozialen Netzwerken innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden müssen – sonst drohen Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro.
Facebook (öffnet in neuem Tab), Google (öffnet in neuem Tab), Microsoft (öffnet in neuem Tab) und Twitter (öffnet in neuem Tab) haben bereits den von der EU-Kommission ausgehandelten, nicht-bindenden Richtlinien über die Entfernung von Posts, die Hassreden beinhalten, zugestimmt. Bis jetzt gibt es jedoch noch kein europaweites Gesetz, das Internetfirmen dazu zwingt, derartiges Material aus dem Netz zu entfernen.