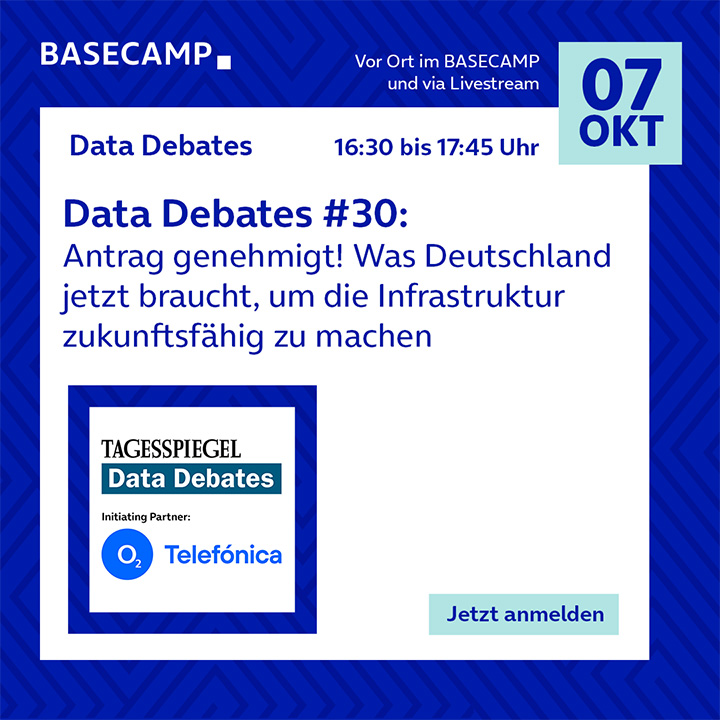Augenhöhe als Anspruch: Was Europa für seine Wettbewerbsfähigkeit tun muss


Die Debatte über Europas Platz im globalen Rennen ist nach der ernüchternden Einigung im Zollstreit mit den USA aktueller denn je. Zwischen geopolitischen Spannungen, wachsendem Protektionismus und einer rasanten Technologie-Evolution steht die EU vor der Frage, wie sie Anschluss hält und dabei ihre gesellschaftlichen und politischen Grundsätze wahren kann. Die Europäische Kommission hat mit dem “Kompass für Wettbewerbsfähigkeit“ und dem angekündigten Digital Networks Act einen breiten Reformfahrplan aufgezeigt. Was bedeutet dies für Europas Wettbewerbsfähigkeit und welche Hebel sind jetzt besonders wichtig?
Die europäische Wirtschaft kommt nicht in die Gänge. Das Wachstum verharrt auf niedrigem Niveau und bleibt hinter vielen G20-Partnern zurück. Ohne strukturelle Modernisierung droht eine langfristige Wohlstandslücke. Auch die geopolitischen Entwicklungen und globalen Handelskonflikte sorgen für Herausforderungen. Der jüngste Deal im Zollstreit zwischen Washington und Brüssel ist dabei sicher alles, aber kein Signal der Entwarnung. Gerade im digitalen und Technologie-Bereich wird die Problematik zwischen dem Wunsch nach internationaler Kooperation und der Notwendigkeit möglichst weitgehender europäischer Souveränität immer offensichtlicher.

Die Europäische Kommission plant daher ein breites Portfolio zur Ankurbelung der Wettbewerbsfähigkeit: Sie will KMU entlasten, den Bürokratieabbau vorantreiben und hemmende Berichtspflichten senken, um Raum für Innovation und Investitionen zu schaffen. Gleichzeitig sollen Handelsdiversifikationen und neue Lieferketten-Partnerschaften Abhängigkeiten von Einzelmärkten reduzieren und Europas strategische Handlungsfreiheit sichern. Dem Telekommunikationssektor kommt eine Schlüsselrolle zu: Er ist Grundvoraussetzung (öffnet in neuem Tab) für Europas digitale und grüne Transformation. Investitionsstarke Netze sind essentiell für wirtschaftliche Sicherheit und Wohlstand.
Rahmenbedingungen zur Stärkung der Position Europas
Die EU verfügt über eine große, gut ausgebildete Erwerbsbevölkerung mit einer Beschäftigungsquote von über 75 % – so hoch wie nie zuvor. Die EU bietet stabile regulatorische Rahmenbedingungen für digitale Technologien, beispielsweise in den Bereichen Daten-Governance, Cyberresilienz und KI. Und Europa ist weltweit führend in der Entwicklung sauberer Technologien wie Windkraft, Elektrolyseure oder kohlenstoffarme Brennstoffe. Gute Grundvoraussetzungen für eine bessere Positionierung im Wettbewerb, allerdings bedarf es dazu mehr Produktivität und Innovation.
Mit dem im Januar 2025 vorgestellten (öffnet in neuem Tab) “Kompass für Wettbewerbsfähigkeit“ bündelt die Kommission erstmals alle Initiativen, die auf mehr Wirtschaftsdynamik einzahlen sollen. Drei Schwerpunkte stehen im Zentrum: die Innovationslücke schließen, die Wirtschaft dekarbonisieren und Abhängigkeiten reduzieren. Flankiert wird der Fahrplan von fünf “Enablern“: Vereinfachung, Binnenmarkt-Harmonisierung, zielgerichtete Finanzierung, Qualifikationsoffensiven und bessere Koordination.

Zentral ist, dass der Aufbau und die Modernisierung der digitalen Infrastruktur nicht weiter verzögert werden. Der Digital Networks Act (DNA), der im vierten Quartal 2025 als Legislativvorschlag erwartet wird, gilt hier als Herzstück. Er soll die Grundlage für eine grenzübergreifende Hochleistungs-Infrastruktur schaffen, die Cloud-Dienste, 5G und künftige KI-Anwendungen nahtlos verbindet. Ziel ist es, regulatorische Hürden abzubauen, um dadurch Investitionen zu fördern und die Netzsicherheit zu erhöhen. Der Entwurf sieht unter anderem einheitlichere Regeln für Frequenzen, den schrittweisen Ersatz von Kupfer durch Glasfaser, gemeinsame Sicherheitsstandards und eine erleichterte grenzübergreifende Zusammenarbeit zur Bündelung der Investitionskraft vor.
Damit kann vor allem die Wettbewerbsfähigkeit der Telekommunikationsbranche nachhaltig gestärkt werden. Von Seiten der Provider und Verbände gibt es bislang Zustimmung zum Grundanliegen, teils jedoch auch deutliche Kritik (öffnet in neuem Tab) an der geplanten Umsetzung. Wichtig ist ein breiter Anwendungsbereich und die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen, damit die in Europa vorhandene Investitionsschwäche im Vergleich zu anderen Regionen der Welt endlich behoben wird.
Weniger Regeln, mehr Wirkung
Eine neue Studie (öffnet in neuem Tab) von Connect Europe zeigt: 34 separate regulatorische Pflichten belasten Telekom-Unternehmen zusätzlich zu ohnehin geltenden Querschnittsregeln. Viele Überschneidungen führen so beispielsweise zu Mehrfach-Berichtspflichten bei Datenschutz, Verbraucherschutz und Netzsicherheit. In der Konsequenz bedeutet dies Hindernisse für Investitionen, die Einführung von 5G sowie grenzüberschreitende Dienste – und damit letztlich für die Erreichung eines europäischen Konnektivitätsökosystems.
Drei Ansätze (öffnet in neuem Tab) zur Modernisierung des europäischen Telekommunikations-Frameworks, um die erfolgreiche Errichtung eines europäischen Binnenmarktes zu fördern, sind nun zentral: Erstens, Marktkonsolidierung auf nationaler Ebene, um Skaleneffekte zu nutzen. Zweitens, tatsächliche regulatorische Vereinfachung statt Harmonisierung, um Fragmentierung entgegenzuwirken. Und drittens, die Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs im Prozess der technologischen Konvergenz.
Souveränität und Handlungsfähigkeit stärken

Im Kontext globaler Entwicklungen zeigt sich die Notwendigkeit der digitalen Souveränität Europas immer deutlicher. Der technologische Wettbewerb, insbesondere mit den USA und China, verdeutlicht, dass Europa seine Handlungsfähigkeit stärken muss, um nicht von externen Akteuren abhängig zu bleiben. Während die USA mit ihrem kürzlich vorgestellten “AI Action Plan“ klar auf wirtschaftliche und geopolitische Dominanz setzen – ohne dabei europäische Partner oder Interessen zu berücksichtigen –, kommt Europa bei der Umsetzung seiner ambitionierten Ziele im Rahmen der “Digitalen Dekade (öffnet in neuem Tab)“ nur schleppend voran. Das verdeutlichte auch der jüngste Besuch von Digitalminister Wildberger in Washington, der zwar für offene Märkte, gemeinsame Standards und enge Partnerschaften gerade im Bereich KI warb, jedoch auch betonte, dass Europa mehr Freiräume für Innovationen schaffen und in Rechenkapazitäten investieren müsse, um tatsächlich eine aktivere Rolle auf der globalen Bühne spielen zu können. Gleichzeitig kann sich die EU in diesem Gefüge als verlässlicher Partner mit einem stabilen Regelwerk demonstrieren.
Wirklich handlungsfähig wird Europa zudem nur, wenn darüber hinaus auch Handelsbeziehungen klug diversifiziert werden. Gerade in Krisenzeiten haben sich solche vielfältigen Handelsnetzwerke als jene Versicherung erwiesen, die Engpässe schnell abfedern können. Mit Partnerschaften von Lateinamerika bis zum Indopazifik baut Europa ein wichtiges Handelsnetzwerk auf, das deutlich resilienter ist und den Zugang zu kritischen Rohstoffen über mehrere Lieferquellen absichert.
Warum Tempo jetzt entscheidend ist
Europa hat das Know-how, den Markt und eine lange Innovationstradition – doch hilft diese nicht viel im aktuellen Wettbewerb mit anderen Regionen, die in vielen Bereichen die Technologie- und Anwendungsführerschaft übernommen haben. Nur mit weniger Regelballast, mehr Investitionen und Raum für Innovation kann Europa seine digitale Renaissance einläuten und eine Wettbewerbsfähigkeit auf Augenhöhe erreichen. Der “Kompass für Wettbewerbsfähigkeit” zeigt die Richtung an, der Digital Networks Act liefert ein wichtiges Werkzeug. Nun ist es an allen Stakeholdern, die Drehzahl hochzuhalten.
KI, Quantencomputing, Edge Cloud und weitere Technologiesprünge werden klassische Marktlogiken infrage stellen und neue Regulierungsfragen aufwerfen. Der globale und aggressiv geführte Wettlauf um die technologische Vorherrschaft zwischen China und den USA ist längst in vollem Gange. Europa kann nur mithalten, wenn es seine Stärken bündelt und konsequent in offene Märkte übersetzt. Gerade darin liegt die historisch gewachsene Stärke: Vielfalt als Innovationsmotor. Wenn die europäische Gemeinschaft diese Stärke endlich freisetzt, kann der Kompass auch den richtigen Kurs für mehr Wettbewerbsfähigkeit weisen.
Mehr Informationen:
EU-Kommission: Wettbewerbsfähigkeitskompass und Arbeitsprogramm 2025 (öffnet in neuem Tab)
Wettbewerbsfähigkeit in der EU: Interview mit Juan Montero Rodil (Telefónica SA) (öffnet in neuem Tab)
Europa Digital: Wettbewerbsfähigkeit und der Stand der digitalen Kommunikation (öffnet in neuem Tab)