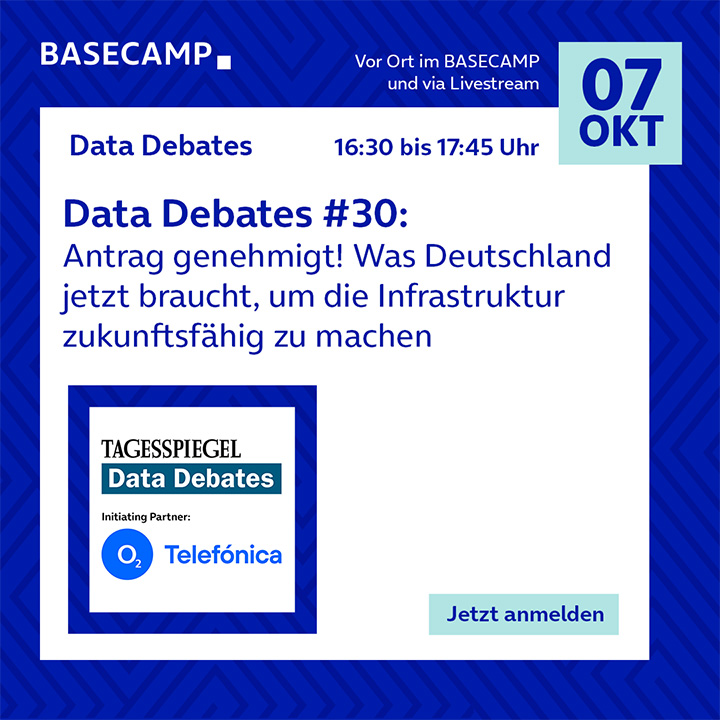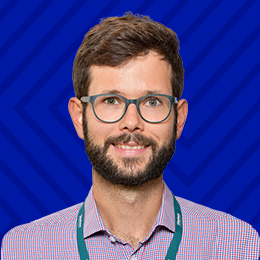100 Tage neue Bundesregierung: Digitalpolitische Bilanz


Mit der Gründung des ersten Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) verband sich zu Beginn der Legislaturperiode die Hoffnung, dass Deutschland in der Digitalpolitik spürbar an Tempo zulegt. Der Anspruch der neuen Bundesregierung: Netze schneller ausbauen, Verwaltung digitalisieren, Bürokratie abbauen und die digitale Souveränität stärken. Dass Deutschland im Bitkom-DESI-Index (öffnet in neuem Tab) aktuell nur Platz 14 belegt und bei der digitalen Verwaltung sogar nur Rang 21 erreicht, verdeutlicht die Dimension der Aufgabe. Dabei bleibt diese Aufgabe trotz des neuen Ressorts ein ressortübergreifendes Querschnittsthema: Fortschritte hängen nicht allein vom Digitalministerium ab, sondern von der Mitwirkung und Bereitschaft aller Ressorts. Dabei treten viele der altbekannten Hürden erneut zutage.
Die 100-Tage-Marke ist ein beliebter Prüfstein für eine neue Regierung. Diese fällt im Falle der Bundesregierung praktischerweise mitten in die Sommerpause. Zeit für eine erste Zwischenbilanz der Digitalpolitik von Union und SPD. Welche Impulse setzen die Ressorts in Sachen Digitalisierung? Wo wurde Tempo gemacht, wo bremsen Abstimmungsprozesse? Und wie fügt sich das neue Digitalministerium in das komplexe Geflecht aus Zuständigkeiten, Prioritäten und Interessenkonflikten ein? Die Antworten darauf geben Aufschluss, ob der versprochene Aufbruch bereits eingelöst wird oder ob zentrale Projekte noch immer im politischen Leerlauf verharren – quasi im Offline-Modus der Bundespolitik.
100 Tage Digitalministerium – Schneller Start, holprige Strecke
Das BMDS hat mit zwei zentralen Vorhaben einen ambitionierten Auftakt hingelegt: Die gesetzliche Festschreibung des Glasfaser- und Mobilfunkausbaus als „überragendes öffentliches Interesse“ soll Verfahren beschleunigen und den Netzausbau bis 2030 vorantreiben. Parallel wurde mit dem National-Once-Only-Technical-System (NOOTS) ein wichtiger Baustein für eine modernisierte, digitale Verwaltung geschaffen, die den sicheren Datenaustausch (öffnet in neuem Tab) zwischen Bund und Ländern ermöglichen soll.
Seit dem Organisationserlass besitzt das Ministerium einen IT-Zustimmungsvorbehalt, dessen Umsetzung jedoch noch abzuwarten bleibt. Eine aktuelle Studie der Agora Digitale Transformation zeigt, dass das Potenzial dieses Instruments (öffnet in neuem Tab)entscheidend davon abhängt, ob es sich nur auf klassische Kern-IT oder auch auf hybride Transformationsprojekte erstreckt – mit einer Spannweite von 3 bis 12 Milliarden Euro an jährlichen IT-Ausgaben.
Organisatorisch befindet sich das Ministerium primär noch im Konsolidierungsmodus. Die anhaltenden Kompetenzstreitigkeiten (öffnet in neuem Tab), vor allem mit dem Bundesfinanzministerium um die Leitung des IT-Dienstleistungszentrums ITZ Bund, beschneiden die Handlungsmöglichkeiten des BMDS erheblich. Das ITZ Bund betreibt mit rund 4.600 Mitarbeitenden zentrale Infrastrukturen wie die Bundescloud und ist ein entscheidender Akteur der Verwaltungsdigitalisierung. Statt der ursprünglich geplanten weitgehenden Übertragung an das Digitalministerium hält das Finanzministerium bisher an wesentlichen Bereichen fest.
Diese Fragmentierung der Zuständigkeiten konterkariert das eigentliche Ziel einer koordinierten Digitalpolitik. Solange dieser Schlüsselakteur nicht unter die strategische Steuerung des BMDS fällt, bleiben dessen Möglichkeiten, Digitalprojekte ressortübergreifend zu orchestrieren und umzusetzen, strukturell begrenzt.
Dennoch positioniert sich das BMDS als zentrale Koordinationsinstanz für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Mit der Einrichtung des „Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau“ versucht es, ressortübergreifende Reformimpulse zu setzen und die digitale Transformation als Querschnittsthema voranzutreiben. Positiv zu vermelden: Eine Lösung für die Standortfrage zeichnet sich ab. Das Ministerium wird in eine Liegenschaft in der Friedrichstraße (öffnet in neuem Tab) ziehen, die derzeit noch vom Gesundheitsministerium genutzt wird. Der vollständige Umzug ist bis Mitte 2026 geplant.
100 Tage Innenministerium – Sicherheit mit Nebenwirkungen
Neben den Gesetzesinitiativen zum Glasfaserausbau und zum Once-Only-Prinzip setzte die Bundesregierung in den ersten 100 Tagen auch in der Cybersicherheit deutliche Akzente. Mit dem Beschluss zur NIS2-Richtlinie steigt die Zahl der Unternehmen, die unter verschärfte IT-Sicherheitsauflagen fallen, von bislang rund 4.500 KRITIS-Betreibern auf etwa 30.000 Unternehmen – ein erheblicher Sprung, der das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zugleich mit erweiterten Befugnissen ausstattet, darunter die Möglichkeit, Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro zu verhängen.

Kontrovers diskutiert wurde die Debatte um den Einsatz der US-Software Palantir, die tiefe Differenzen zwischen Bund und Ländern offenlegte. Während Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen Palantir bereits nutzen, sprechen sich Bremen und Niedersachsen (öffnet in neuem Tab)explizit für europäische Alternativen aus. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt prüft den Einsatz auf Bundesebene im Rahmen seines „Sicherheitspakets“, während Digitalminister Karsten Wildberger den technologiegestützten Schutz von Staat und Demokratie grundsätzlich unterstützt (öffnet in neuem Tab), jedoch die Notwendigkeit einer langfristigen europäischen Souveränitätsstrategie betont. Dabei mahnt (öffnet in neuem Tab) BSI-Präsidentin Claudia Plattner zur Realitätsnähe: Trotz sichtbarer Fortschritte – Deutschland belegt im Digital Sovereignty Index (öffnet in neuem Tab) immerhin Platz 2 bei selbst gehosteten Open-Source-Lösungen – haben vor allem US-Tech-Unternehmen rund zehn Jahre Vorsprung bei Investitionen, sodass Deutschland seine technologische Abhängigkeit kurzfristig nicht komplett überwinden kann.
Dass entsprechende Vorhaben – wie das auf die Entwicklung einer eigenen Analyse und Ermittlungssoftware ausgerichtete Projekt „NASA“ (öffnet in neuem Tab) – bislang an fehlender Finanzierung scheiterten, unterstreicht die chronischen Herausforderungen für mehr digitale Souveränität im Sicherheits- und Digitalbereich.
100 Tage Justizministerium – Überraschungssieger
Einen digitalpolitischen Turbo zündete überraschenderweise das Bundesjustizministerium unter Stefanie Hubig und zwar mit sichtbaren Fortschritten (öffnet in neuem Tab) sowohl auf Kabinetts- als auch auf Entwurfsebene. Zwei zentrale Projekte haben bereits die Hürde des Kabinettsbeschlusses genommen: die generelle Zulassung elektronischer Beurkundungen und die Einführung eines nutzerfreundlichen Online-Verfahrens für Klagen vor Amtsgerichten. Beide stehen kurz vor der parlamentarischen Beratung.
Flankierend legte das Ministerium eine ganze Palette weiterer Gesetzentwürfe vor: von vollständig digitalen Grundstückskaufverträgen über den elektronischen Widerrufsbutton bis hin zur weiteren Digitalisierung der Zwangsvollstreckung und der Modernisierung des Genossenschaftsrechts. Politisch abgerundet wird dieser Digitalisierungsschub durch eine mit den Ländern verabschiedete gemeinsame KI-Erklärung, die Effizienzgewinne anstrebt, zugleich aber die menschliche Entscheidungsautorität in der Justiz unmissverständlich festschreibt.
100 Tage im restlichen Kabinett – Licht und Schatten
Im Vergleich dazu geben sich die weiteren Ressorts digitalpolitisch eher zurückhaltend: Häufig beschränken sich ihre Aktivitäten auf Einzelmaßnahmen oder flankierende Projekte, ohne eine kohärente Gesamtstrategie zu entwickeln. Mit dem digitalen Bauantrag setzt Bundesbauministerin Verena Hubertz ein ermutigendes Zeichen: Unter dem Nachnutzungsmodell (öffnet in neuem Tab) „Einer für Alle“ (EfA), das Mecklenburg-Vorpommern federführend entwickelt hat, sind mittlerweile 13 Bundesländer angeschlossen. Die Hälfte aller Kommunen nutzt das System bereits – ein klarer Fortschritt, der Tempo, Flexibilität und Transparenz in die Baugenehmigungsverfahren bringt. Hubertz betont, dass das Land großes Potenzial habe, Aktenberge und analoge Prozesse endgültig ins digitale Zeitalter zu überführen. Die vollständige bundesweite Einführung bleibt das Ziel, um die Effizienz der Verwaltung spürbar zu steigern. Forschungsministerin Dorothee Bär setzt mit der „Hightech Agenda“ und den angekündigten 18 Milliarden Euro bis 2029 zwar langfristige Akzente, doch zentrale Initiativen wie ein Forschungsdatengesetz sind bislang nur in Planung.

Das Landwirtschaftsministerium verfolgt einen eher pragmatischen Ansatz: Statt umfassender Digitalisierung konzentriert es sich auf Bürokratieabbau, um bestehende analoge Abhängigkeiten zu reduzieren, etwa bei Regelungen für Weinbaubetriebe oder beim Düngen. Das Wirtschaftsministerium setzt dazu mit dem neuen Vergabebeschleunigungsgesetz ähnlich wie das Landwirtschaftsministerium, das weniger Berichtspflichten will, auch Akzente im Bereich Staatsmodernisierung. Das Umweltministerium setzt einen ersten “Lichtblick” mit der Verleihung des „Blauen Engels“ für nachhaltige, quelloffene Software als Zeichen dafür, dass Digitalisierung auch im Klima- und Ressourcenschutz Bedeutung hat. Allerdings bleibt dieser Impuls vorerst vor allem symbolisch. Für nachhaltigen Fortschritt sind weitergehende und verbindliche Maßnahmen nötig.
Zwischenfazit – Herausforderung angenommen
Der digitalpolitische Regierungssprint nach gut drei Monaten ist kein Anlass für Euphorie, doch gemessen an den von Versäumnissen und Entschuldigungen geprägten letzten Jahrzehnten bietet er berechtigten Anlass zur Hoffnung.
Digitalminister Wildberger stellte gleich zu Beginn seiner Amtszeit klar, dass Digitalpolitik „kein Schalter ist, den man einfach umlegt, sondern ein langwieriger Prozess, der Zeit, Mut, Expertise und Geduld erfordert“. Mit dieser Einschätzung liegt der ehemalige Manager zwar richtig, doch hat auch er nur noch eine (knappe) Legislatur, um tiefgreifende Verwaltungsreformen, bessere Ressortkoordination und vor allem die Bündelung digitalpolitischer Kompetenzen voranzutreiben. Sein 100-Tage-Resümee auf LinkedIn (öffnet in neuem Tab) lässt erkennen, dass in der Anfangsphase vor allem Fortschritte bei der Staatsmodernisierung im Vordergrund standen, während Digitalisierungsfragen zwar thematisiert, aber weniger stark betont wurden.
Für den weiteren Kurs wird es entscheidend sein, beide Aufgabenbereiche des Ressorts gleichmäßig im Blick zu behalten und deren Verzahnung konsequent voranzutreiben. Die schwarz-rote Digitalpolitik steht also erst am Anfang ihrer Bewährungsprobe. Nach der Sommerpause wird sich zeigen, ob die Bundesregierung die bestehenden Probleme gezielter und koordinierter angeht.
Mehr Informationen:
Augenhöhe als Anspruch: Was Europa für seine Wettbewerbsfähigkeit tun muss
Ambitioniert, aber ambivalent: Zwischenzeugnis für Schwarz-Rot
Digitalsteuer-Debatte: Ein Überblick über die EU-Modelle