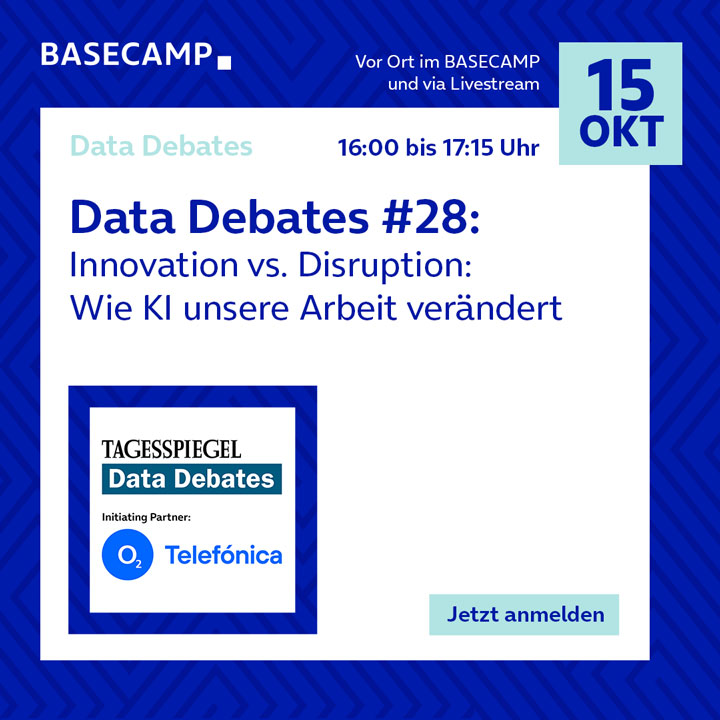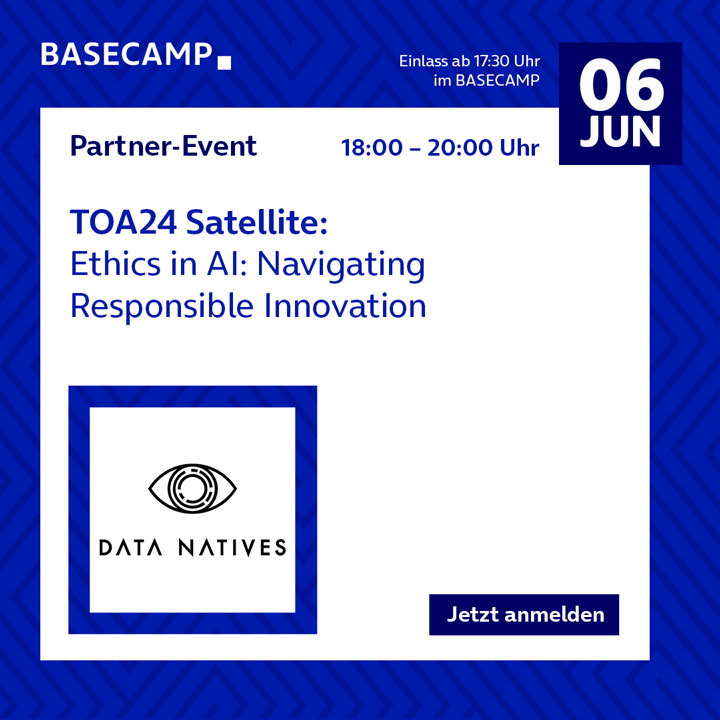KI verstehen: Wo stehen wir aktuell beim Urheberrecht im Zeitalter der Maschinen?


Am 2. August 2025 traten erstmals zentrale Bestimmungen des EU AI Acts in Kraft. Zeitgleich hat die EU-Kommission einen ergänzenden „Code of Practice“ veröffentlicht – ein freiwilliger Leitfaden für Anbieter generativer KI-Modelle. Darin formuliert sind klare Erwartungen: mehr Transparenz, besserer Schutz geistigen Eigentums und technische Maßnahmen für mehr Sicherheit. Ziel ist es, die neuen Regeln der KI-Verordnung frühzeitig praktisch umzusetzen. Insbesondere dort, wo gesetzliche Vorgaben bislang noch offen oder unkonkret sind. Etwa beim Umgang mit urheberrechtlich geschützten Inhalten im KI-Training.
Besonders relevant ist dabei der Umgang mit urheberrechtlich geschützten Inhalten. Anbieter sollen nicht nur offenlegen, ob schöpferisches Eigentum beim Training verwendet wurde. Sie werden auch angehalten, technische Maßnahmen zur Vermeidung rechtswidriger Reproduktionen zu ergreifen und das Prinzip der „Fairness gegenüber Rechteinhabern“ stärker zu beachten.
Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Denn die rechtliche Lage zum Thema „KI und Urheberrecht“ ist in Bewegung, aber weiterhin geprägt von Unsicherheit. Während eine neue EU-Studie das bisherige Opt-out-Prinzip beim KI-Training infrage stellt und ein Hamburger Urteil Urheberrechtsverletzungen durch KI-Anbieter grundsätzlich für möglich hält, sorgt auch Meta für zusätzliche Dynamik. Der Konzern kündigte an, künftig öffentlich zugängliche Inhalte von Anwendern für das KI-Training zu nutzen – gestützt auf die bisherige Opt-out-Regelung.
Was bedeutet eigentlich „Opt-out“ – und warum fordern viele ein „Opt-in“?
Beim Text- und Data Mining (TDM) nach §44b UrhG dürfen KI-Anbieter Inhalte aus öffentlich zugänglichen Quellen analysieren – es sei denn, Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber widersprechen ausdrücklich. Dieses Verfahren nennt man Opt-out.
Kritikerinnen und Kritiker fordern stattdessen ein Opt-in-Modell: Inhalte dürften nur dann für das KI-Training genutzt werden, wenn die Urheberinnen und Urheber vorher aktiv zustimmen. Eine Studie im Auftrag der EU-Kommission von 2024 sieht im Opt-out-Verfahren ein rechtliches und ethisches Problem – denn es stellt faktisch Schweigen mit Zustimmung gleich.)
Was heißt das für Urheber, Plattformbetreiber und Nutzer von KI-Inhalten? Der folgende Überblick ordnet die aktuelle Lage ein – von der Frage, ob KI-generierter Content geschützt ist, bis zu den Anforderungen, die künftig für das Training und die Veröffentlichung solcher Inhalte gelten könnten.
KI-generierte Inhalte: Wann entsteht überhaupt ein Urheberrecht?

Eine der grundlegendsten Fragen lautet: Können KI-generierte Werke, ob Text, Bild oder Musik, überhaupt urheberrechtlich geschützt sein? Die Antwort nach aktueller deutscher Rechtslage ist eindeutig. Nein, wenn kein menschlicher Beitrag mit eigener Schöpfungshöhe vorliegt. Vollständig maschinell erzeugte Inhalte gelten nicht als „Werk“ im Sinne des Urheberrechts.
Erst wenn der Mensch aktiv kreativ eingreift, etwa durch aufwendige Bearbeitung oder besonders originelle Prompts, kann im Einzelfall ein Schutz entstehen. Einfache Eingaben wie „male ein Porträt im Stil von Monet“ reichen dafür nicht aus.
Noch komplizierter wird es beim sogenannten „Training“ von KI-Modellen. Dabei analysieren Systeme riesige Datenmengen, um aus Texten, Bildern oder Audio neue Inhalte generieren zu können. Oft geschieht das auf Basis frei verfügbarer Webinhalte. Darunter auch urheberrechtlich geschützte Werke.
Laut §44b UrhG ist das sogenannte „Text- und Data Mining“ erlaubt – es sei denn, Rechteinhaber widersprechen aktiv (Opt-out). Doch viele wissen gar nicht, dass ihre Werke genutzt werden oder wie man sich effektiv wehrt. Und für kommerzielle KI-Anwendungen reicht das nicht. Hier braucht es in der Regel eine Lizenz. Fehlt sie, kann eine Urheberrechtsverletzung vorliegen.
Juristische Studien wie die der Initiative Urheberrecht kommen deshalb zu einem klaren Urteil: Das massenhafte Training generativer KI ist rechtlich hochproblematisch und in vielen Fällen nicht durch bestehende Ausnahmen gedeckt.
Gesetzliche Regeln und ihre Lücken

Mit dem EU AI Act versucht die Europäische Union, hier neue Standards zu setzen. Die Verordnung verpflichtet Anbieter großer KI-Modelle zu umfassender Transparenz. Sie müssen dokumentieren, mit welchen Datensätzen ihre Systeme trainiert wurden und ob urheberrechtlich geschützte Werke darunter waren. Zudem greift die Opt-out-Regelung aus der DSM-Richtlinie. Rechteinhaber können die Nutzung untersagen.
Doch wie weit diese Regelungen reichen, ist unklar. In Deutschland entschied das Landgericht Hamburg 2024 erstmals zu KI-Datensätzen. Die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke zum Training kann rechtswidrig sein – Ausnahmen gelten nur eingeschränkt, etwa in der Forschung.
Erstes Gerichtsurteil zu KI und Urheberrecht in Deutschland
Das Landgericht Hamburg entschied im September 2024 erstmals zur Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke für das KI-Training (Az. 310 O 227/23). Geklagt hatte ein Fotograf gegen das LAION-Projekt, das Milliarden Bild-Text-Paare für Trainingszwecke bereitstellt.
Das Urteil:
Die Nutzung wurde im konkreten Fall als zulässiges Text- und Data-Mining für Forschungszwecke (§ 60d UrhG) eingestuft – nicht als Urheberrechtsverletzung.
Gleichzeitig stellte das Gericht klar: Die Frage, ob das eigentliche KI-Training rechtswidrig ist, bleibt offen.
Was sagt die Kreativbranche?
Die Stimmen aus Kunst, Kultur und Verlagswesen sind deutlich. Es brauche klare Vergütungsmodelle, neue Lizenzmechanismen und verlässliche Regeln, um kreative Arbeit zu schützen. Der Deutsche Kulturrat spricht von einer drohenden „Enteignung“ durch KI-Training. Auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels fordert mehr Transparenz über Trainingsdaten und einen stärkeren rechtlichen Schutz für Urheber.
Gleichzeitig betonen viele Verbände: Es geht nicht um ein pauschales Nein zu KI, sondern um eine faire Teilhabe an ihren Möglichkeiten. Kreative wollen gestalten aber nicht enteignet werden.
Der politische Handlungsdruck steigt auch durch laufende Gerichtsverfahren in Europa und den USA. Wenn KI-Systeme künftig Milliarden Texte, Bilder und Sounds verarbeiten, muss geregelt sein, wie geistiges Eigentum geschützt und gerecht vergütet wird. Die Weichen dafür werden jetzt gestellt – durch Gesetze, politische Debatten, aber auch das Handeln von Unternehmen und Plattformen.
Mehr Informationen:
KI verstehen: Was ist Künstliche Intelligenz und warum wird sie reguliert?
KI verstehen: Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem AI Act?
KI verstehen: Was sagt das Urheberrecht zu KI?