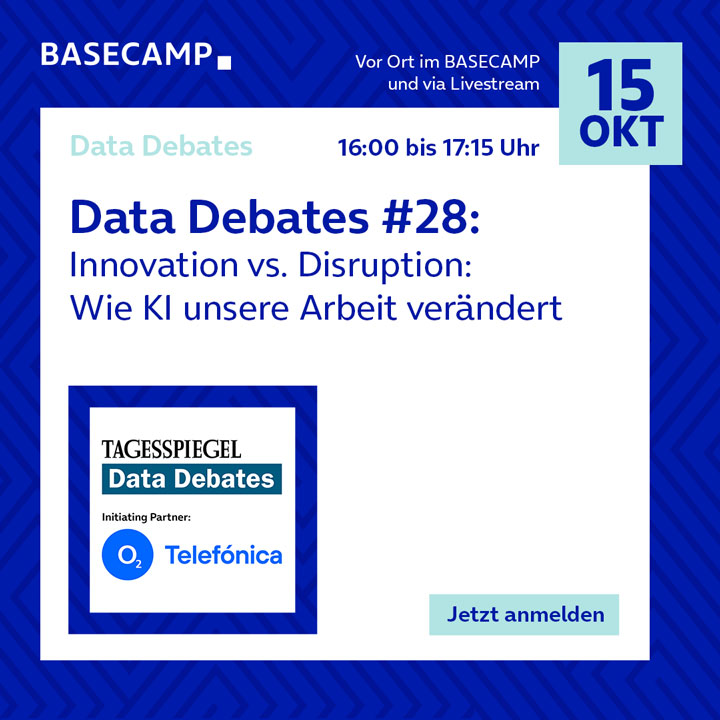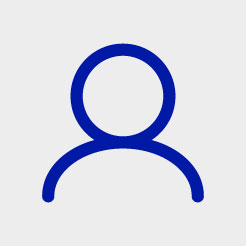Initiative „Smart Country“ des CoLab präsentiert Ergebnisse


Vor kurzem präsentierte die 10. Initiative (öffnet in neuem Tab) des Internet & Gesellschaft Collaboratory (öffnet in neuem Tab) Handlungsempfehlungen (öffnet in neuem Tab) zum Thema Smart Country bei ihrer Abschlussveranstaltung (öffnet in neuem Tab) in Berlin. In Abgrenzung zu Smart City hatten sich seit Juli Experten mit verschiedenen beruflichen Hintergründen in sechs Arbeitsgruppen mit den Schwerpunkten Energie, Pflege und Gesundheit, Mobilität und Logistik, Verwaltung und Politik, Wertschöpfung sowie Bildung befasst und Lösungsansätze erarbeitet, um die ländlichen Regionen in Deutschland an den Chancen der Digitalisierung teilhaben zu lassen.
Empfehlungen für gelungene Projekte
Unter anderem evaluierten die Experten (öffnet in neuem Tab) laufende und abgeschlossene Projekte im ländlichen Raum, um daraus Erfolgsfaktoren für eine gelungene Umsetzung von Projektideen abzuleiten. So stellte sich beispielsweise die Stadt-Land-Partnerschaft als ein entscheidender Aspekt heraus, denn Wertschöpfungsketten finden meist nicht vollständig nur in der Stadt oder nur auf dem Land statt. Die Vernetzung von Expertise und die Zusammenarbeit von Städtern und Landbewohnern sei ein zentrales Kriterium für die erfolgreiche Fortführung eines Projekts. In den ländlichen Regionen sollten gut vernetzte Personen und Institutionen umfassend in das Projekt eingebunden werden, um zu vermeiden, dass Ideen aus der Stadt von den Bewohnern vor Ort als aufdringlich und unrealistisch empfunden werden.

Darüber hinaus empfehlen die Experten eine stets gute und klare Kommunikation zwischen den Initiatoren, den Betroffenen und den Unterstützern eines Projekts zu pflegen. Für eine bessere Verankerung vor Ort seien Exklusiv-Verträge mit lokalen Anbietern empfehlenswert. Außerdem sei es vorteilhaft die Politik einzubinden, um einem Projekt mehr Aufmerksamkeit, Reichweite und Unterstützung zu sichern. Vor allem sollten bestehende und etablierte Strukturen genutzt werden, etwa Räumlichkeiten der Gemeinde oder das Netzwerk eines ortsansässigen Vereins. Die konkreten Handlungsempfehlungen pro Themenfeld sind auf einem eigens eingerichteten Online-Portal (öffnet in neuem Tab) des Collaboratory einzusehen und in einer Broschüre – die man unter anderem im BASE_camp bekommt – nachzulesen.
Paneldiskussion zur Digitalen Agenda
Bei der Abschlussveranstaltung fand neben der Ergebnispräsentation der Arbeitsgruppen auch eine Paneldiskussion zum Thema „Welche Chancen bringt die Digitale Agenda für Land und Leute?” statt. Moderiert von Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21 (öffnet in neuem Tab) und Mitglied des Collaboratory Lenkungskreises (öffnet in neuem Tab), diskutierten die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken (öffnet in neuem Tab), Franz-Reinhard Habbel vom Deutschen Städte- und Gemeindebund (öffnet in neuem Tab), Fabien Nestmann (öffnet in neuem Tab), Sprecher des Unternehmens Uber und die Projektleiterin der Initiative Code4Germany (öffnet in neuem Tab), Julia Kloiber, über digitale Innovationspotenziale im ländlichen Raum. Das Video von der Diskussion findet man hier (öffnet in neuem Tab).
Der vorstehende Artikel erscheint im Rahmen einer Kooperation mit dem Berliner Informationsdienst (öffnet in neuem Tab) auf UdL Digital. Aylin Ünal ist als Redakteurin des wöchentlichen Monitoringdienstes für das Themenfeld Netzpolitik verantwortlich.