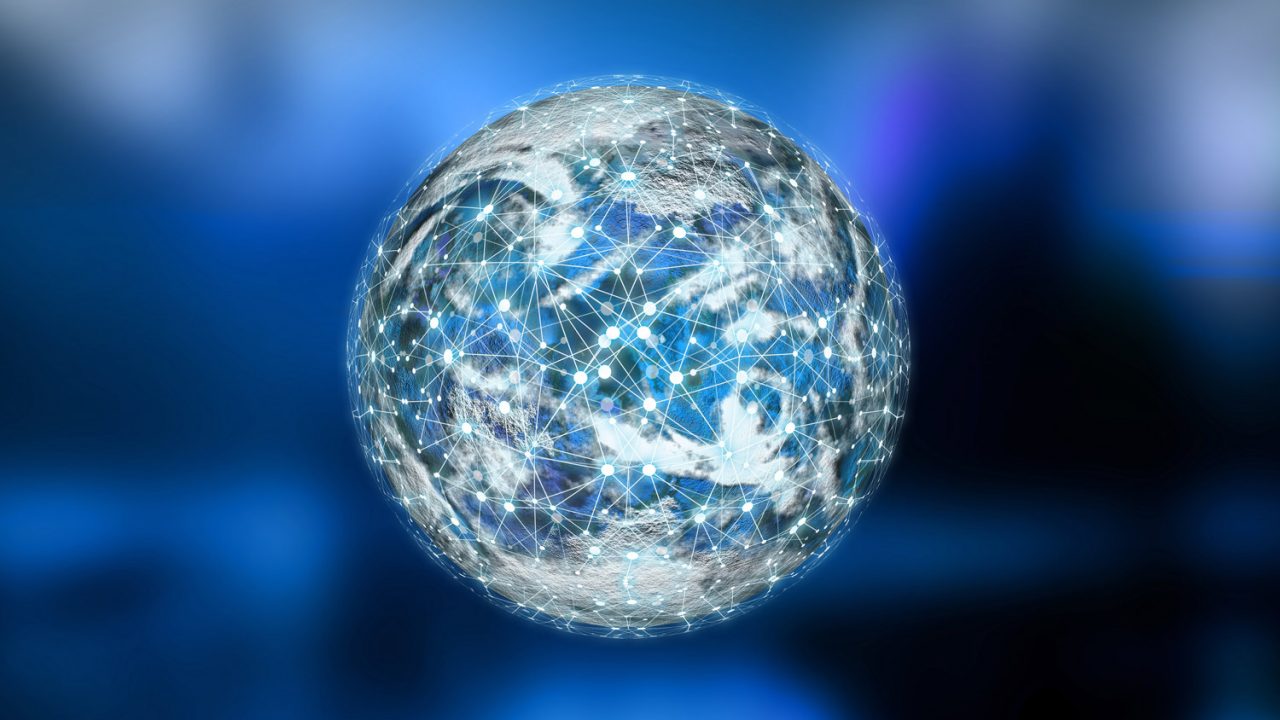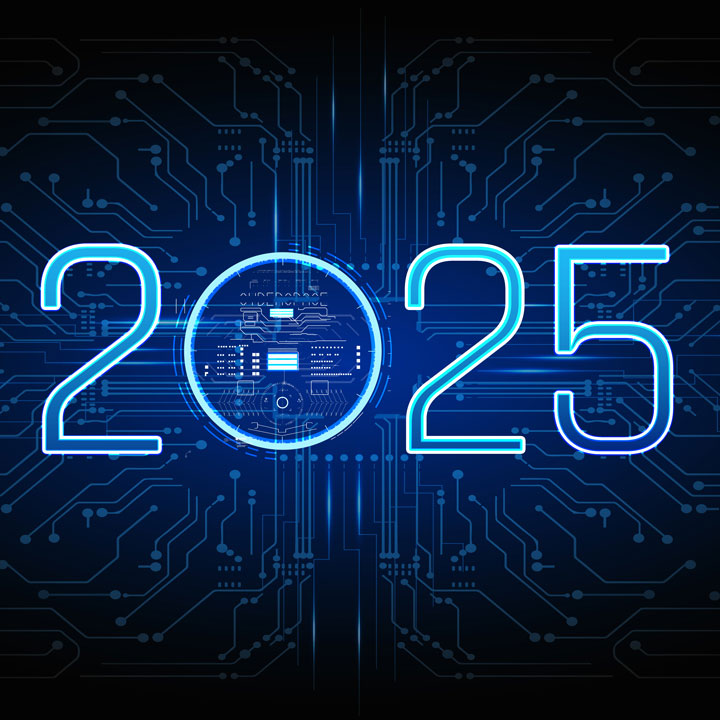Blockchain: Kommt die Bitnation?

Seit kurzem ist eine Technologie in der Politik angekommen: Blockchain. Gleich sieben Mal kam der Begriff im Koalitionsvertrag 2018 vor, 2013 dagegen kein einziges Mal. Während wir allerdings noch auf die im Koalitionspapier (öffnet in neuem Tab) erwähnte „Blockchain-Strategie“ warten, loten bereits diverse Initiativen, Start-ups und Organisationen die Potenziale von Blockchain für eine neue Art der Regierungsführung aus, eine „Staatlichkeit 2.0“. Betrachtet man so manche Idee, denkt man: Die traditionelle Politik sollte sich beim Thema Blockchain beeilen – damit sie bei ihrer eigenen Abschaffung mitdiskutieren kann.
Es war einmal – ein Nationalstaat
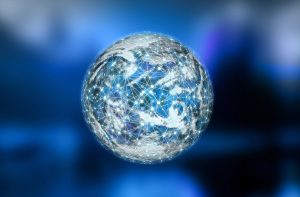
Fragt man Susanne Tempelhof (öffnet in neuem Tab) von Bitnation (öffnet in neuem Tab), könnten Nationalstaaten schon bald der Vergangenheit angehören. Durch ihre 2014 gegründete „Bitnation“ sollen traditionelle Staaten bis 2050 überflüssig gemacht werden. Warum? Weil sie der Meinung ist, dass mit Hilfe von Blockchain das Zusammenleben von Menschen weitaus effektiver, transparenter und ohne Diskriminierung und Korruption organisiert werden kann.
Schon seit Mitte der 90er Jahre gründen Leute virtuelle Staaten – zum Beispiel auf nationstates.net (öffnet in neuem Tab) die meritokratische Technokratie „Technopulse“ oder das „Königreich Pottyland“ – doch das mehr zum Spaß. Auch auf Bitnation können sich Menschen aus aller Welt und ohne geografische Nähe zu verschiedenen Staatsformen zusammenschließen. Bitnation macht ernst, indem es proklamiert, echte Verwaltungsakte und Regierungsleistungen mit Hilfe von dezentralen Datenbankenabwickeln zu können. Die Idee: Anders als in der realen Welt, wo Institutionen dafür sorgen, dass die Bürger und Marktteilnehmer sich gegenseitig vertrauen, übernimmt in der Bitnation eine Blockchain diese Aufgabe. Die dezentral geführte Datenbank speichert verschlüsselt alle Interaktionen und Transaktionen zwischen Bürgern, die durch einen individuellen Code identifizierbar sind. So sollen Institutionen als Kontrollinstrument gar nicht mehr nötig sein. Einmal geschriebene Daten sind nicht mehr veränderbar.
Zehntausende sind seit 2014 „Bürger“ der Bitnation geworden, heißt es auf der Webseite der Initiative. Vielen Menschen gefällt daran die Freiwilligkeit. In eine politische Schicksalsgemeinschaft hineingeboren zu werden, an die man (meistens) für immer gebunden ist, zählt dort nicht mehr. Außerdem gibt es keinen politischen Zwang – zum Beispiel diese oder jene Steuer zu zahlen. Doch liegt darin nicht genau das Problem? Kann ohne einen gewissen politischen Zwang überhaupt Minderheitenschutz oder der Wohlstand aller durch Umverteilung sichergestellt werden?
„Es gibt weltweit eigentlich keine guten Beispiele von rein freiwilligen, also philanthropisch finanzierten Sozialwesen. Funktionierende Sozialsysteme basieren auf einem Zwang, in Steuern oder andere Solidarsysteme einzuzahlen. Das kann eine auf Freiwilligkeit beruhende Blockchain nicht“,
schreibt Franz von Weizsäcker (öffnet in neuem Tab), Leiter des Blockchain Labs bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (öffnet in neuem Tab) (GIZ) auf netzpolitik.org, wo er kürzlich acht Missverständnisse über Blockchain (öffnet in neuem Tab) aufgeklärte. Missverständnis Nummer acht: „Blockchains machen Staaten überflüssig“.
Vision vs. Realpolitik
Die Partei, die wohl am ehesten mit der marktwirtschaftlichen, technokratischen Überzeugung von Susanne Tempelhof mitgehen würde, ist die FDP. Auch dort pflegen einige Mitglieder libertäre Gedanken und zudem zeigt sich die Partei offen gegenüber technischen Neuerungen. Lobeshymnen für Tempelhofs Idee waren aus der Partei nicht zu vernehmen. Auf dem letzten Bundesparteitag (öffnet in neuem Tab) ließ der FDP-Vorsitzende Christian Lindner (öffnet in neuem Tab) allerdings verlauten:
„Ein Land, dass sich mehr mit Karl Marx beschäftigt als mit Blockchain, ist dabei, den Anschluss zu verlieren.“
Karl Marx wäre wohl nicht überzeugt gewesen von einer Bitnation, in der jeder Aspekt des Zusammenlebens über das marktwirtschaftliche Prinzip von Angebot und Nachfrage geregelt wird.
Mit einer Kleinen Anfrage (öffnet in neuem Tab) zu Blockchain im Februar wollte die FDP-Fraktion im Bundestag der Bundesregierung Druck machen. Sieben Mal „Blockchain“ im Koalitionsvertrag hin oder her – laut der FDP-Generalsekretärin Nicola Beer (öffnet in neuem Tab) offenbarte die Antwort die Unwissenheit der Bundesregierung. Auf Twitter schrieb sie (öffnet in neuem Tab):
„Wir brauchen zukunftssichere gesetzliche Rahmenbedingungen für die Blockchain“.
Regulatory Sandboxes
Auch die Informatikerin und Gründerin des BlockchainHub Network (öffnet in neuem Tab) Shermin Voshmgir wünscht sich einen klareren Rechtsrahmen für die Blockchain-Szene. Das sagte sie beim UdL Digital Talk zu Blockchain (öffnet in neuem Tab) vor rund einem Jahr, wo sie mit dem damaligen Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Jens Spahn (öffnet in neuem Tab), diskutierte. Weil ein Rechtsrahmen fehle, würden Gründungen, die in Berlin entwickeln, sich rechtlich im schweizerischen Zug oder im US-Bundesstaat Delaware ansiedeln. Ihr Vorschlag: mehr „Regulatory Sandboxes“.
Genau diese vermisst der Blockchain Bundesverband (öffnet in neuem Tab) im Koalitionsvertrag, wo er ansonsten viele seiner Kernforderungen wiederfand.
„Grundsätzlich müssen gerade für den dynamischen Blockchain-Bereich Sandboxing-Möglichkeiten geschaffen werden, damit neue Ideen ohne künstliche Hemmnisse ausprobiert werden können. Nur die Erfahrungen, die dabei entstehen, können auf zukünftige Regulierungsbedarfe hinweisen“.