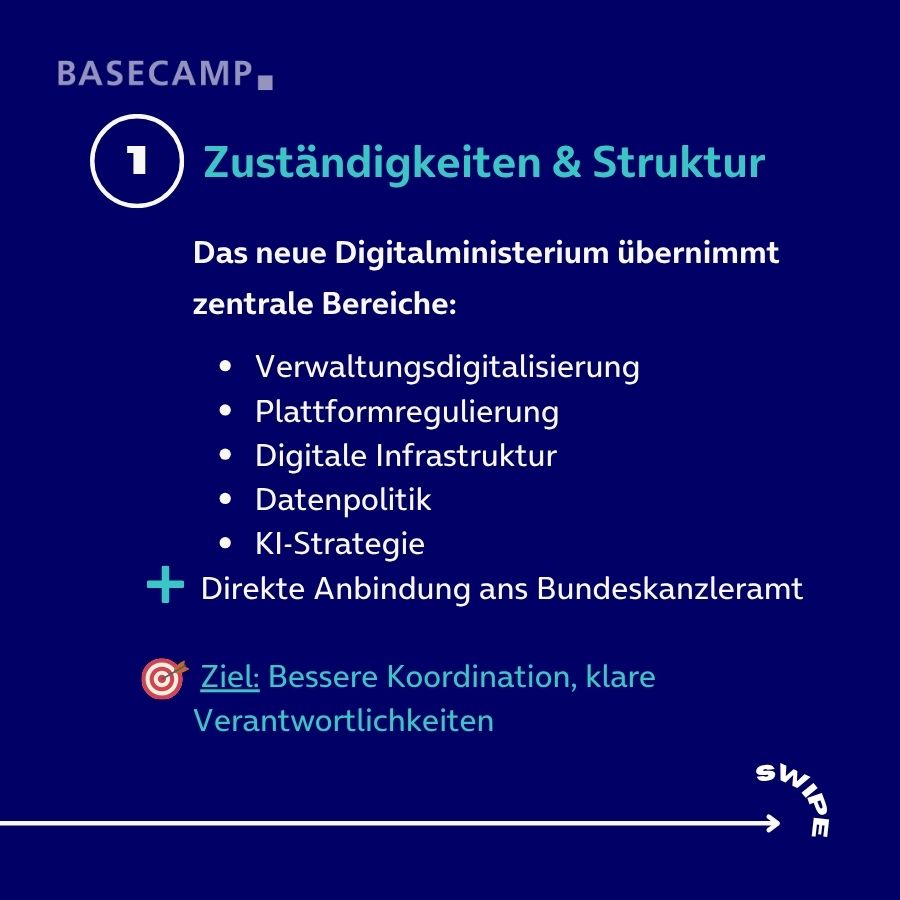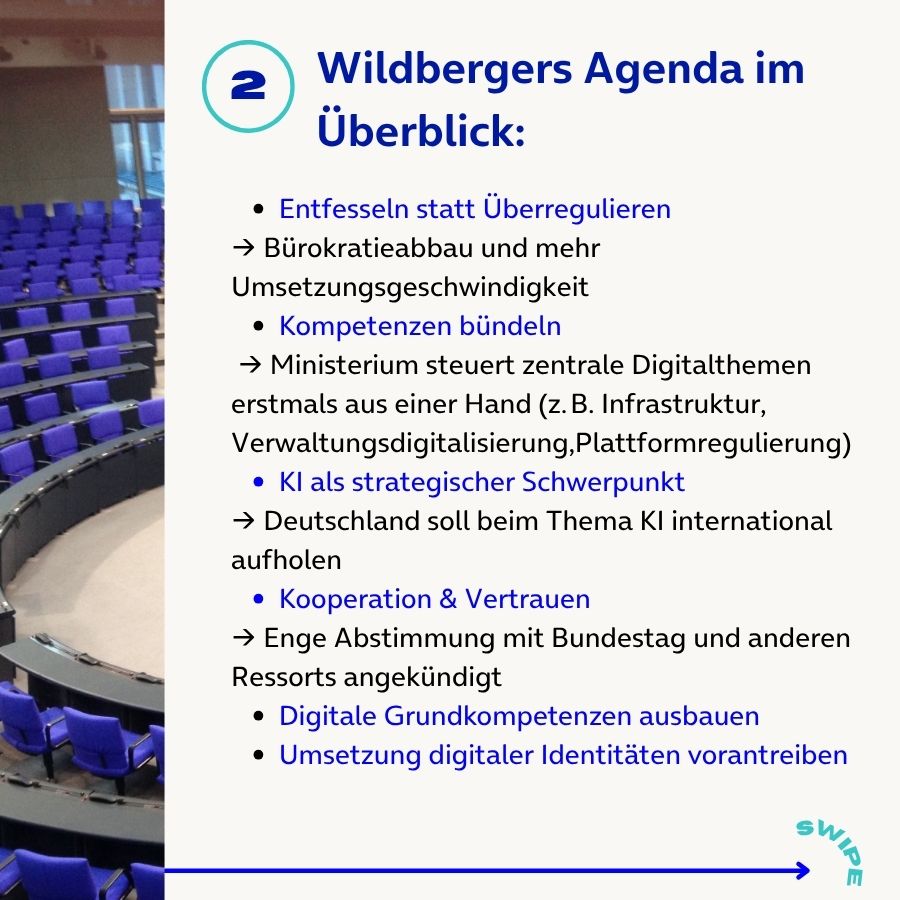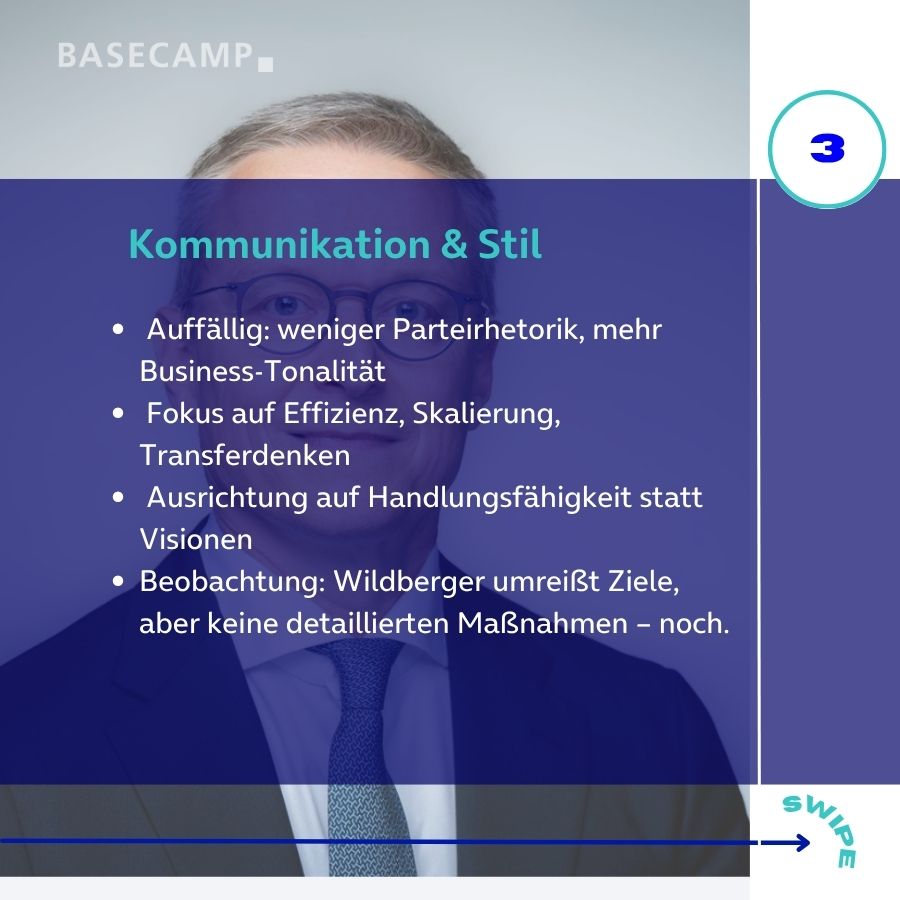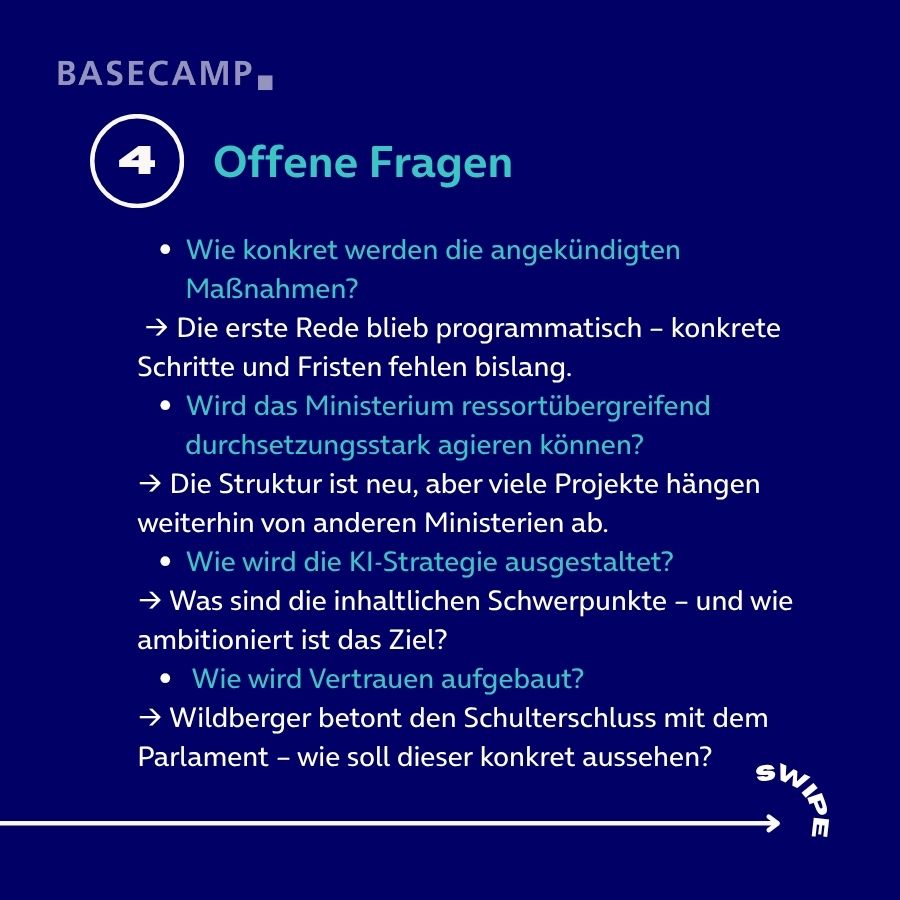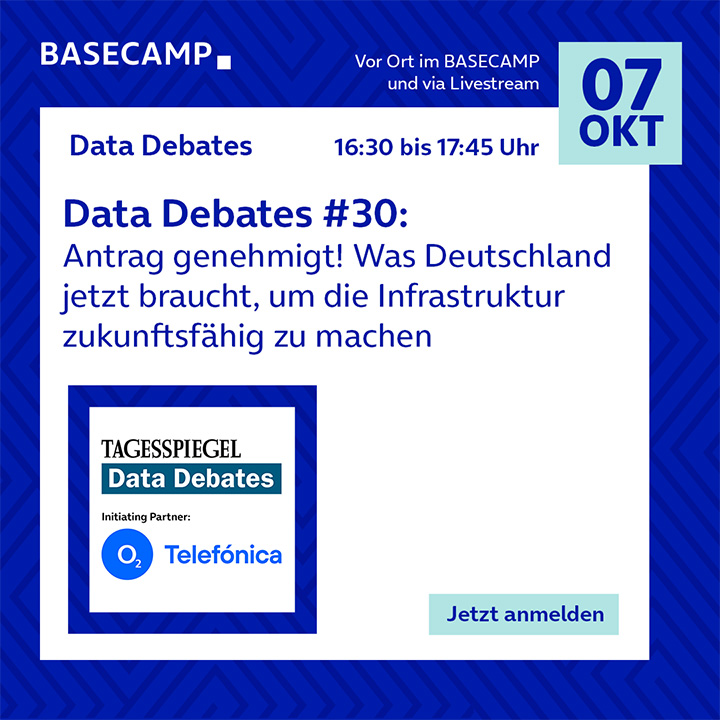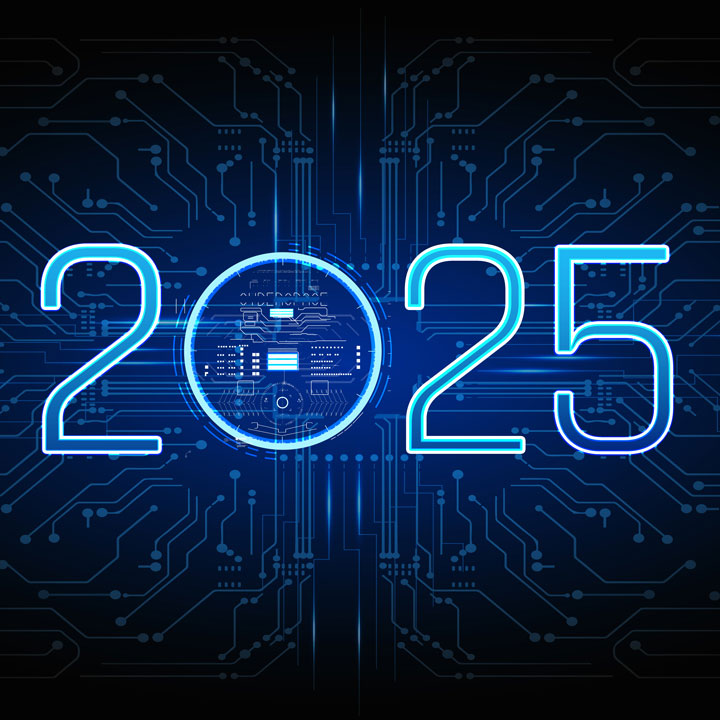Wildbergers Parlamentspremiere: Die Regierungsagenda des neuen Digitalministers


Neues Ministerium, Novize in der Bundespolitik und nun auch die erste Rede vor dem Parlament: Digitalminister Karsten Wildberger hatte am Freitag mit seiner Regierungserklärung im Bundestag hohe Erwartungen zu erfüllen. Hier eine erste Analyse seiner zentralen Aussagen zu seiner Mission eines „Digitalen Next Germany“.
„Endlich ein Ministerium für Digitales, endlich ein Ministerium für Staatsmodernisierung“ – das hat Wildberger in den letzten Tagen wohl so oft gehört, dass er damit seine erste Bundestagsrede eröffnete und beendete. Die Worte sind symbolisch für die hohen Erwartungen, die an das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) geknüpft sind.
Karsten Wildberger, Ex-Ceconomy-Chef und Kabinettsneuling aus der Wirtschaft, will das Ministerium als Teamplayer aufbauen, um die digitale Transformation von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft endlich ganzheitlich zu steuern. Seine Antrittsrede im Bundestag sollte dafür den richtigen Ton setzen.
Antrittsbesuche bei den wichtigsten Behörden
In seiner circa zehnminütigen Rede (öffnet in neuem Tab) bot das seit Mai frischgebackene CDU-Mitglied zwar einen Überblick der relevanten Themenfelder, blieb sonst aber eher im Vagen, und ging auch rhetorisch kein Risiko ein. Einige richtungsweisende Positionen und Vorzeichen für seine politische Agenda der nächsten Jahre ließen sich dennoch feststellen.

Zum Einstieg blickte er auf seine ersten Tage im Amt zurück: Bei Besuchen der verschiedenen Behörden (öffnet in neuem Tab) in seinem neuen Zuständigkeitsbereich – namentlich das ITZ-Bund, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die Bundesnetzagentur und die BDBOS – hat er sich ein erstes Bild von den Abläufen und Strukturen gemacht. Was die Detailfragen zu den Verantwortlichkeiten zwischen den einzelnen Behörden angeht – vor allem, wenn mehrere Ministerien beteiligt sind – blieb vorerst unkommentiert.
Er hob vor allem die fachliche Kompetenz seines Teams und die gemeinsame Haltung hervor: „Ich erlebe rund um mein Haus eine Start-up-Mentalität“, so Wildberger – der Wille, etwas zu bewegen, sei überall spürbar. Wie dieses neue Start-up-Haus den entscheidenden Schub bei der Digitalisierung und Staatsmodernisierung schaffen möchte, machte er an drei Punkten fest, die Kernpunkte seiner Ausführung waren:
1. Der digitale Staat: Verwaltung mit UX-Fokus
Ein zentrales Element von Wildbergers Vision ist die Modernisierung der Verwaltung. Er will einen Staat, der digital funktioniert und dabei auf Nutzer:innenfreundlichkeit bzw. dem Fall Bürger:innenfreundlichkeit setzt. Wildberger kündigt mit dem „Deutschland-Stack“ die Schaffung einer standardisierten IT-Infrastruktur an. Dieser soll zentrale Basiskomponenten wie Cloud- und IT-Dienste bündeln, klar definierte Schnittstellen vorweisen und einen starken Fokus auf Cybersicherheit haben.

Ein weiteres zentrales Vorhaben ist die digitale Identität – eine „Wallet“, in der Ausweise, Führerschein oder Tickets digital und sicher zusammengeführt werden. Für Wildberger ist klar: Digitalisierung muss bei den Menschen ankommen. Sie soll barrierefrei, verständlich und alltagstauglich sein. Bei der Entwicklung und Umsetzung des digitalen Wallets muss sich das neue Haus erstmals als Teamplayer beweisen. Denn obwohl Zuständigkeiten neu verteilt wurden, liegt das Pass- und Ausweiswesen, sowie das Identitätsmanagement weiterhin beim BMI. Eine enge Zusammenarbeit ist also unerlässlich.
2. Digitale Infrastruktur: “Daten müssen fließen”
Wildberger betrachtet eine moderne Infrastruktur als Grundlage für die digitale Transformation. Glasfaser– und 5G-Ausbau seien dafür zentral. Die Verantwortung dafür sieht er in erster Linie bei der Wirtschaft; der Staat solle vor allem geeignete Rahmenbedingungen schaffen. Bei Bedarf, etwa in infrastruktur-schwächeren Regionen, könne auch öffentliche Förderung eine Rolle spielen. Wie diese ausgestaltet sein soll, ließ er offen Im Fokus steht für ihn, Deutschland als Standort für Investitionen attraktiver zu machen.
3. BMDS als Wachstumsmotor für die Wirtschaft
Wie beim Thema Infrastrukturausbau bereits angekündigt, setzt Wildberger auch im Bereich Wirtschaft auf verlässliche Rahmenbedingungen als zentrale politische Aufgabe. Eine moderne Datenpolitik, klare Leitplanken für den Einsatz Künstlicher Intelligenz und die Förderung digitaler Geschäftsmodelle sollen dabei helfen, Deutschland als Standort für Innovationen zu stärken – national wie europäisch. Besonders Gründerinnen und Gründer, die mit Daten und KI arbeiten, sollen hier ideale Voraussetzungen vorfinden. Datenschutz und Datensicherheit bleiben für Wildberger unverzichtbare Grundpfeiler, jedoch „[…] darf Datenschutz nicht zur Innovationsbremse werden“. Deutschland müsse mutiger werden, neue digitale Geschäftsmodelle zu testen, zu skalieren und international wettbewerbsfähig zu machen. Ziel ist es, Unternehmen – vom Start-up bis zum etablierten Mittelständler – den Rücken freizuhalten, damit sie sich auf Wachstum und Ideen konzentrieren können.
Er schließt seine Rede mit dem Anspruch, „im besten Sinne ein Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zu sein“ – vor allem durch den Abbau bürokratischer Hürden. Gefordert sei eine Verwaltung, die der gestalterischen Kraft von Menschen und Unternehmen mehr Vertrauen entgegenbringt. Mut sei dafür notwendig. Wie lange dieser Mut gefordert sein wird, bleibt offen – konkrete zeitliche Zielmarken ließ die Rede außen vor.
Anschließende Debatte
Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und Koalitionspartner Armand Zorn (öffnet in neuem Tab) ergänzte in seinem Redebeitrag Wildbergers 3 Grundpfeiler unter anderem um das Leitprinzip von Souveränität und Innovation als zentrale Voraussetzungen für Gestaltungsfähigkeit und ein Schlüssel, um bestehende Abhängigkeiten zu überwinden. Er verwies zudem auf Ziele aus dem Koalitionsvertrag, insbesondere auf die Stärkung eines mündigen und informierten Bürgers durch eine Kompetenzoffensive. Datenschutz und Nutzen müssten dabei in ein besseres Verhältnis gebracht und das Gemeinwohl stärker berücksichtigt werden. Den Koalitionsvertrag lobte er als solides Fundament für eine echte Digitalisierungswende – im Unterschied zur letzten Legislaturperiode sei mit dem Digitalministerium nun auch die strukturelle Basis vorhanden.
Für die Opposition reagierten Bundestags-Neulinge wie Rebecca Lenhard (Grüne) und Donata Vogtschmidt (Linke) und gewährten dem neuen Minister einen gewissen Startbonus. Lenhard (öffnet in neuem Tab), die als Informatikerin und IT-Beraterin profunden fachlichen Hintergrund mitbringt, mahnte aber, Ressourcenverbrauch, Klimaschutz und Arbeitsmarkteffekte nicht aus dem Blick zu verlieren. Digitalisierung versteht sie als „Werkzeug für Zusammenhalt und echte Teilhabe“.
Vogtschmidt (öffnet in neuem Tab) (Linke) blickt besonders kritisch auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. „KI als Allheilmittel schön und gut, aber kein Wort zu Energieverbrauch, Diskriminierung und Transparenz“, kritisierte sie. Vogtschmidt warnt davor, dass KI soziale Ungleichheiten weiter verschärfen könne, und fordert eine klare Regulierung – insbesondere beim Einsatz von KI in der Bundeswehr. Ihr Appell: „Digitalpolitik muss für alle gemacht werden – und nicht für Profite.“
Erwartungsgemäß entgegneten die AfD-Vertreter Beatrix von Storch und Edgar Naujok mit Digital Services Act-Zensur- Vorwürfen und Verschwörungserzählungen nach dem Motto, „Brüssel will bestimmen, was wir denken dürfen!“.
Wildberger entschied sich bei seiner Antrittsrede also für einen risikoarmen Start: Die zentralen digitalpolitischen Baustellen wurden adressiert, wichtige Schlagworte fielen, die Aura der Regierungsverantwortung beschworen. Erwartungsmanagement betrieb er vor allem über die Betonung von Beharrlichkeit und Zeitbedarf. Das neue Ministerium werde nichts im Handumdrehen schaffen. „Für Digitalisierung gibt es keinen Schalter, den man einfach umlegt. Digitalisierung ist ein Prozess“, sagte Wildberger und unterstrich damit die langfristige Perspektive seiner Agenda. Zunächst muss aber sein Haus mit der operativen Arbeit starten, was bei einem völlig neuen Bundesministerium schwierig genug sein dürfte.
Wildberger und sein Team haben nun (hoffentlich) eine ganze Legislatur Zeit, lang erwartete und nun vorsichtig angekündigte Lösungen zu liefern. Die 100-Tage-Bilanz in der Sommerpause wird ein erster Meilenstein sein.
Mehr Informationen:
Im Digital-Check: Das Merz-Kabinett
Neue Macht für die Digitalisierung: Wildbergers Ministerium im Überblick
Neue Bundesregierung: Digitalpolitik und Telekommunikation im Koalitionsvertrag