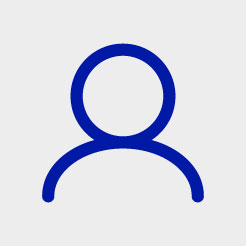Justizministerkonferenz: Neue Beschlüsse zu Cybermobbing und Justiz-IT


Die 85. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister (öffnet in neuem Tab) fand am 25. und 26. Juni 2014 auf Rügen statt. Die Teilnehmer einigten sich auf Beschlüsse (öffnet in neuem Tab) zu Cybermobbing und Justiz-IT.
Beschlüsse zu Cybermobbing und Justiz-IT
Mit dem Beschluss zum Cybermobbing (öffnet in neuem Tab) zeigen sich die Justizminister besorgt über die gestiegene Zahl von Beleidigungen und Diffamierungen im Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken. Daher bitten sie den Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz zu prüfen, „ob das Unrecht des Cybermobbings durch die geltenden strafrechtlichen Vorschriften angemessen erfasst wird und ob sie die erforderliche generalpräventive Wirkung entfalten“. An die Betreiber sozialer Netzwerke appellierten die Minister, Maßnahmen gegen Cybermobbing zu ergreifen. Dafür schlagen sie etwa die Einrichtung von Hilfe- und Beratungsteams sowie Melde- und Löschmechanismen vor. Letztere seien kurzfristig und effektiv, heben sie hervor. Vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils zum sogenannten „Recht auf Vergessenwerden im Internet“ plädieren sie dafür, dass der Bundesjustizminister mit den Betreibern über entsprechende Lösungsmöglichkeiten diskutiert, etwa im Rahmen eines Rundes Tisches.
Außerdem beschäftigten sich die Justizminister der Bundesländer mit dem Bericht des E-Justice-Rats zur Verbesserung der Justiz-IT und empfehlen (öffnet in neuem Tab), das Gutachten der Grobkostenschätzung zur Umsetzung des Gesetzes zu Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten bei den Haushaltsverhandlungen in Bund und Ländern einzubringen. Sie empfehlen weiterhin, das Gutachten sowie den Bericht an die Finanzministerkonferenz zu übermitteln.
Keine Einigung bei Vorratsdatenspeicherung

Stimmen zum Thema
Jürgen Martens (öffnet in neuem Tab) (FDP), Justizminister des Landes Sachsen
Das grundlose Speichern sämtlicher Telekommunikationsverkehrsdaten ohne Verdacht für eine Straftat oder einer konkreten Gefahr stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte der Bürger dar. Die Vorratsdatenspeicherung ermöglicht weitreichende Einblicke in das Bewegungs- und Kommunikationsverhalten des Einzelnen und erlaubt Rückschlüsse auf soziale Beziehungen und individuelle Verhaltensweisen. Sie stellt alle Bürger unter Generalverdacht und bewirkt bei ihnen ein Gefühl des Beobachtetseins. Das Vertrauen in die freie Kommunikation und die Wahrnehmung der Grundrechte wird dadurch beeinträchtigt. Niemand bislang der Nutzen der Vorratsdatenspeicherung für die Aufklärung von Straftaten belegen können. Die Freiheitsrechte der Bürger haben hier Vorrang.
(sachsen.de (öffnet in neuem Tab), 20.06.2014)
Der vorstehende Artikel erscheint im Rahmen einer Kooperation mit dem Berliner Informationsdienst (öffnet in neuem Tab) auf UdL Digital und ist Teil der aktuellen Ausgabe (öffnet in neuem Tab) zur Netzpolitik. Aylin Ünal ist als Redakteurin des wöchentlich erscheinenden Monitoring-Services für das Themenfeld Netzpolitik verantwortlich.