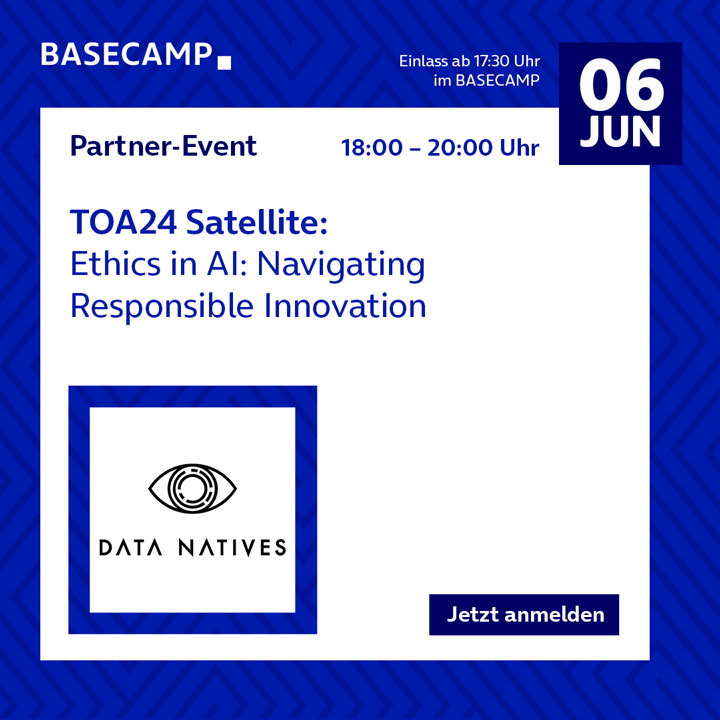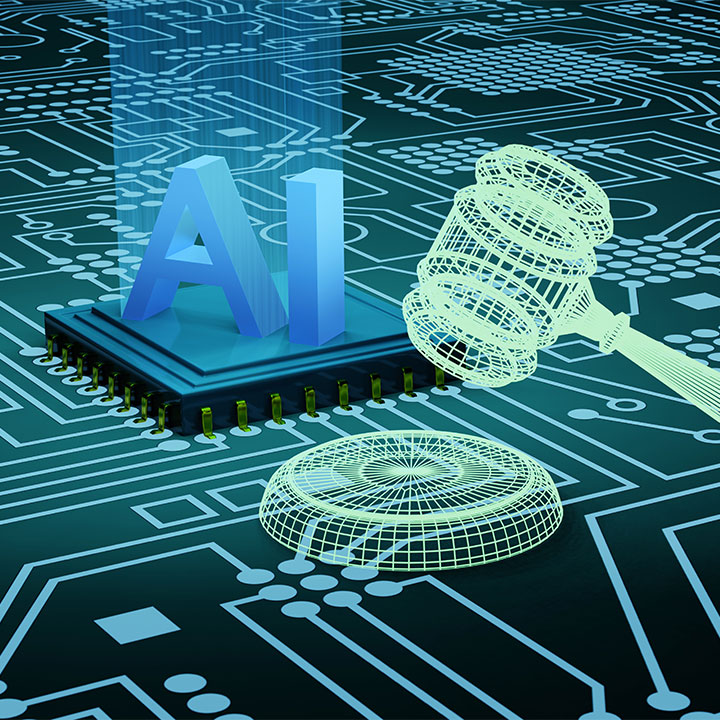Auch Chatbots haben Fußabdrücke: KI als Klimafluch und -segen

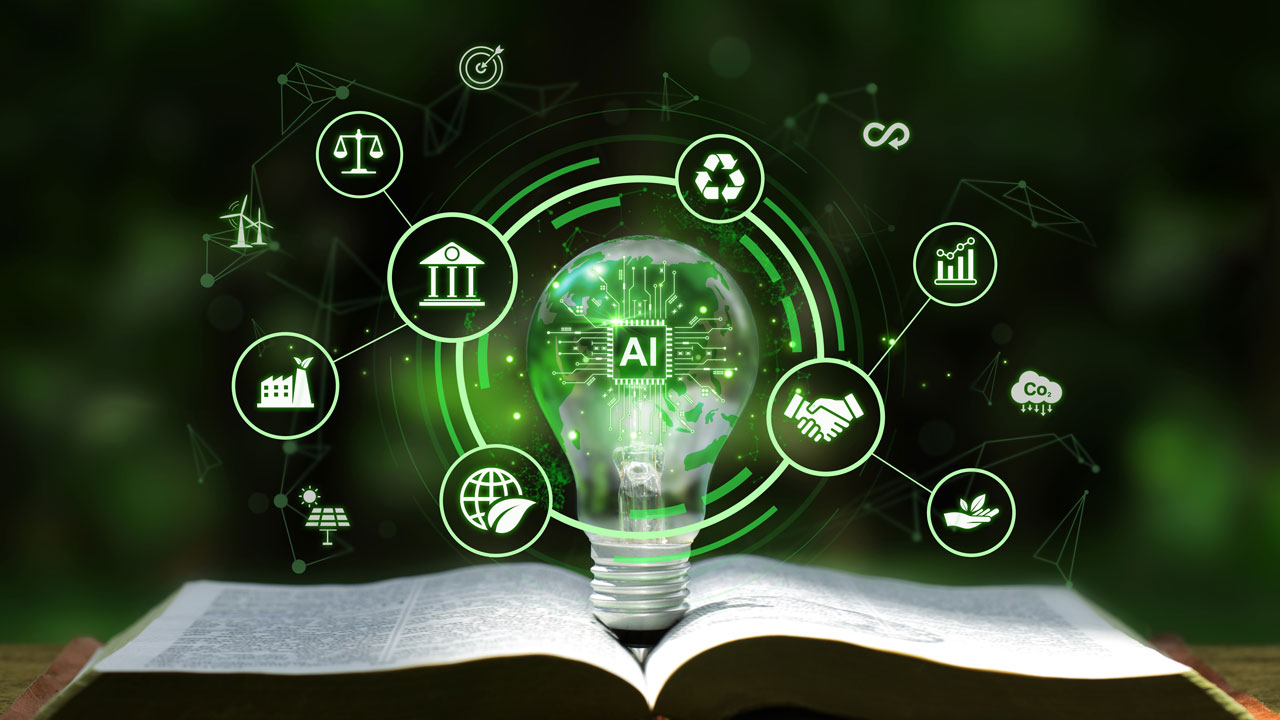
Künstliche Intelligenz ist eine Projektionsfläche für allerlei wohlklingende Zukunftsvisionen: Sie soll unsere Arbeit erleichtern, Innovationen beschleunigen und auch die Klimakrise lösen. Doch während die KI-Branche neue Rekorde feiert, steigen Stromverbrauch und CO₂-Emissionen dramatisch an. Kann eine Technologie, die derart energiehungrig ist, überhaupt klimafreundlich sein? Oder suchen wir nach einer technologischen Lösung für ein Problem, das die Technologie selbst mitverursacht?
Die Zahlen sind ernüchternd: Der Stromverbrauch (öffnet in neuem Tab) von Rechenzentren, die von KI- unterstützte Dienstleistungen anbieten, wird 2030 elfmal so hoch sein wie im Jahr 2023. Eine einzige ChatGPT-Anfrage verbraucht etwa zehnmal (öffnet in neuem Tab) mehr Energie als eine klassische Google-Suche. Große Tech-Konzerne wie Google, Microsoft und Meta haben ihre selbstgesteckten Klimaziele (öffnet in neuem Tab) praktisch aufgegeben – Google verzeichnete zwischen 2019 und 2023 einen Anstieg der Treibhausgasemissionen um 48 Prozent. Der Hauptgrund: der massive Ausbau von KI-Infrastrukturen.
Gleichzeitig wird Künstliche Intelligenz (öffnet in neuem Tab) oft als Hoffnungsträger im Kampf gegen die Klimakrise angepriesen. Sie soll unter anderem dazu beitragen, Energienetze zu optimieren, die Kreislaufwirtschaft voranzubringen und effizientere Produktionsprozesse zu ermöglichen. Dabei ist die eigentliche Frage nicht, ob KI gut oder schlecht für das Klima ist, sondern vielmehr unter welchen Bedingungen ihr Einsatz unter dem Nachhaltigkeitsaspekt gerechtfertigt werden kann.
Der unsichtbare Fußabdruck: Wie viel Energie braucht KI wirklich?
Im Jahr 2024 wurden rund 20 Milliarden Kilowattstunden (kWh), was etwa 3,9 Prozent des gesamten deutschen Stromverbrauchs entspricht, für Rechenzentren genutzt. Laut Schätzungen der Bundesregierung (öffnet in neuem Tab) dürfte sich diese Zahl bis 2037 fast verdoppeln. Der Grund liegt in der Art, wie moderne KI-Systeme lernen: Im Unterschied zum klassischen Computing basiert Machine Learning (öffnet in neuem Tab) auf einem iterativen Prozess, bei dem Maschinen anhand gewaltiger Datenmengen eigenständig Muster erkennen und daraus Modelle entwickeln. Dieses Training erfordert spezialisierte Rechenbeschleuniger, Graphics Processing Units (GPUs), die über Wochen hinweg ununterbrochen laufen. Sie verarbeiten nicht nur riesige Daten-, sondern verschlingen dabei auch enorme Strommengen. Allein das Training von ChatGPT in der Version 3 hat schätzungsweise 500 Tonnen CO₂ (öffnet in neuem Tab) verursacht, bevor auch nur eine einzige Anfrage beantwortet wurde.

Die Konsequenzen (öffnet in neuem Tab)der Ausweitung KI-gestützter Modelle sind bereits jetzt spürbar. Allein im tech-lastigen Irland entfallen inzwischen über 20 Prozent des gesamten Stromverbrauchs auf Rechenzentren – in der Hauptstadt Dublin, in dem viele Digitalkonzerne sitzen, sind es nahezu 80 Prozent. Auch in Metropolen wie Amsterdam, London und Frankfurt bewegen sich die Anteile bereits zwischen 30 und 40 Prozent, wodurch vielerorts die Stromnetze an ihre Grenzen stoßen. Der geplante Ausbau weiterer Rechenzentren ruft zunehmend Widerstand (öffnet in neuem Tab) hervor: Immer häufiger protestieren Anwohner, Aktivistinnen und Umweltorganisationen – zuletzt verstärkt im besonders betroffenen Irland.
Doch die Umweltfolgen reichen weit über die enorme Stromnachfrage hinaus: Insbesondere die Kühlung der Hochleistungsrechner verschlingt enorme Mengen Wasser. Laut Schätzungen des Öko-Instituts (öffnet in neuem Tab) im Auftrag von Greenpeace wird sich der globale Wasserverbrauch zur Kühlung von Rechenzentren von 175 Milliarden Litern im Jahr 2023 auf 663 Milliarden Liter im Jahr 2030 beinahe vervierfachen.
Das gebrochene Versprechen: KI als Klimalösung?
Trotz alarmierender Zahlen ist KI nicht per se klimaschädlich. So spricht das Bundesministerium (öffnet in neuem Tab) für Umwelt KI-Technologien ein “enormes Potenzial, den ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen“, zu. Auch die Europäische Kommission (öffnet in neuem Tab) unterstreicht das transformative Potenzial von KI für Europas Energiewende: KI-gestützte Systeme könnten das Netzmanagement revolutionieren, indem sie Energieverbrauch und Produktionsmuster präzise vorhersagen, die Integration erneuerbarer Energien optimieren und damit entscheidend zur Erreichung der EU-Klimaziele beitragen.
Besonders profitieren könnte die angewandte Umweltforschung (öffnet in neuem Tab). Da die Wechselwirkungen zwischen Ökosystemen und Lebewesen hochkomplex sind, ist es oft schwer vorherzusehen, wie sich diese mit dem Klimawandel verändern oder welche Folgen Eingriffe in die Natur haben. KI-gestützte Systeme ermöglichen eine wesentlich präzisere Analyse von Umweltprozessen und die Entwicklung realitätsnaher, detaillierter Modelle, mit deren Hilfe sich beispielsweise Gefahrengebiete für Erdrutsche deutlich genauer identifizieren und kartieren lassen.
Exemplarisch dafür ist das Projekt „Future-Forest (öffnet in neuem Tab)“, bei dem ein intelligentes Zusammenspiel von Umweltdaten und KI verschiedenste Informationen, von Baumarten und Waldvitalität über Bodenzustände, Schädlingsbefall und Klimadaten, zusammenführt, um die Widerstandsfähigkeit verschiedener Baumarten und -gruppen zu vergleichen. Die daraus entstandenen Szenarien bilden die Grundlage für die Entwicklung klimaresilienter Forstwirtschaft.
Diesen verheißungsvollen Aussichten steht aber der sogenannte Rebound-Effekt (öffnet in neuem Tab) entgegen: Effizienzgewinne führen oft dazu, dass Technologien intensiver genutzt werden – und der Gesamtverbrauch am Ende steigt statt sinkt. Dieses Phänomen, auch als Jevons-Paradoxon bekannt, zeigt sich bereits beim KI-Einsatz: Die leichtere Verfügbarkeit führt zu mehr Anfragen, nicht zu weniger Energieverbrauch.
Was jetzt passieren muss
Wenn KI Teil einer nachhaltigen Zukunft sein soll, braucht es klare politische Rahmenbedingungen. Neben verpflichtenden Transparenzstandards für KI-Dienstleister, sollten auch nur dort Rechenzentren gebaut werden, wo zusätzlicher Strombedarf mit erneuerbaren Energien gedeckt werden kann – und zwar zeitlich abgestimmt mit deren Verfügbarkeit.
Auf europäischer Ebene lässt auch der erst im letzten Jahr in Kraft getretene EU AI Act (öffnet in neuem Tab) im Thema Klimaschutz zu wünschen übrig. So gibt es Kritik (öffnet in neuem Tab) an den genannten Umweltmaßnahmen, die größtenteils auf Freiwilligkeit basieren. Konkrete Ergänzungsvorschläge (öffnet in neuem Tab) betreffen bisher hauptsächlich Datenzugriffsrechte für wissenschaftliche Bewertungen von Umweltauswirkungen, um unter anderem die indirekten Wirkungen von KI-Anwendungen besser zu erfassen. Aus diesen Daten sollen dann Schwellenwerte definiert werden, die anschließend Meldepflichten für relevante Sektoren ermöglichen.

Letztlich könnten auch sogenannte “impact assessment frameworks” von Unternehmen verlangen, die ökologischen Auswirkungen ihrer KI-Dienstleistungen systematisch und schon vor der Markteinführung zu evaluieren. Solche Assessments könnten dazu beitragen, schädliche Anwendungen frühzeitig zu identifizieren, Verbesserungen aufzudecken und sowohl direkte als auch indirekte Effekte, etwa bei der Standortwahl von Rechenzentren, zu berücksichtigen.
Ein weiterer Ausweg aus dem Dilemma könnte in der Entwicklung spezialisierter KI-Anwendungen liegen. Statt auf immer größere, allwissende Sprachmodelle zu setzen, könnten kleinere, auf spezifische Aufgaben zugeschnittene KI-Systeme zum Einsatz kommen. Diese benötigen weniger Rechenleistung, weniger Daten und damit weniger Energie.
Auch auf Geschäftsebene braucht es mehr Bewusstsein für den gezielten und verantwortungsvollen Einsatz von KI. Eine aktuelle Analyse des MIT Media Lab (öffnet in neuem Tab) zeigt, dass rund 95 Prozent der Unternehmen bisher keinen messbaren Mehrwert aus ihren KI-Investitionen ziehen – ein Hinweis darauf, dass KI kein Allheilmittel ist, das automatisch jeden Prozess verbessert. Unternehmen sollten daher sorgfältig prüfen, wo der Einsatz von KI tatsächlich Effizienz und Nachhaltigkeit steigert, anstatt sie als Selbstzweck in alle Abläufe zu integrieren.
Eine Orientierung bietet beispielsweise das Öko-Institut mit einem Fünf-Punkte-Plan (öffnet in neuem Tab) für die nachhaltige Entwicklung und Nutzung von KI vor. Ausgangspunkt ist, dass KI-Projekte nur umgesetzt werden sollten, wenn ihre ökologischen Vorteile den aufgebrachten Ressourcenverbrauch rechtfertigen. Wenn eine einfachere, regelbasierte oder analoge Lösung das Ziel erreichen kann, sollte diese bevorzugt werden.
Dass besonders Transparenzstandards von großer Bedeutung sind, betont auch Jens Gröger (öffnet in neuem Tab), Senior Researcher am Öko-Institut: „Was ich nicht messe oder nicht kenne, kann ich auch nicht optimieren.“ Dabei plädiert er für ein Energielabel für digitale Dienstleistungen – ähnlich wie bei Haushaltsgeräten. Die Idee: Erst wenn Nutzerinnen sehen können, wie viel CO₂ ihre digitale Aktivität verursacht, entsteht ein Bewusstsein und möglicherweise auch ein Wettbewerb um effizientere Lösungen.
Und in der Tat darf und sollte auch auf individueller Ebene hinterfragt werden, ob die x-te Bildgenerierung for fun unbedingt notwendig ist oder es die einfache Suchmaschinen-Abfrage nicht vielleicht auch tut.
Eine Technologie auf der Suche nach einem Problem?
Green AI ist kein Widerspruch in sich – aber sie erfordert einen radikalen Kurswechsel. Solange KI-Systeme primär nach dem Prinzip “größer ist besser” entwickelt werden, bleibt die Technologie ein Klimaproblem und keine Klimalösung. Auch die verbreitete Haltung des “alles mit KI” ist irreführend. Nicht jeder Prozess wird durch den Einsatz von KI automatisch besser, effizienter oder nachhaltiger.
KI kann ein nützliches Werkzeug für effizientere Energiesysteme oder für präzisere Umweltüberwachung sein. Doch dafür brauchen wir keine allwissenden Superintelligenzen, sondern spezialisierte, transparente und demokratisch kontrollierte Systeme. Die entscheidende Frage ist nicht, ob KI klimafreundlich werden kann, sondern ob wir bereit sind, die notwendigen politischen Entscheidungen zu treffen.
Je länger diese Entscheidungen aufgeschoben werden, desto stärker gerät das “business as usual” außer Kontrolle. Unternehmen treiben den Einsatz von KI voran, ohne regulatorische Grenzen, während Stromnetze unter dem extremen Ausbau von Rechenzentren zu kollabieren drohen. Wenn wir nicht mit mehr Dringlichkeit handeln, riskieren wir entweder den wirtschaftlichen Kollaps von Firmen, die blind auf KI setzen, oder den infrastrukturellen Zusammenbruch von Energiesystemen, die diesen Hunger nicht mehr stillen können. Dabei gilt: Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung für einen klimatisch instabilen KI-Wilden Westen.
Die Diskussion um “Green AI” steht erst am Anfang. Transparenz, klare Regulierung und ein bewusster Umgang mit der Technologie sind dabei entscheidend. Nur so kann KI zu einem essentiellen Baustein für eine nachhaltige digitale Zukunft werden
Mehr Informationen:
KI verstehen: Was ist Green AI? (öffnet in neuem Tab)
Digitalisierte Nachhaltigkeit und nachhaltige Digitalisierung: Was Union und SPD jetzt angehen sollten (öffnet in neuem Tab)
KI verstehen: Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem AI Act? (öffnet in neuem Tab)