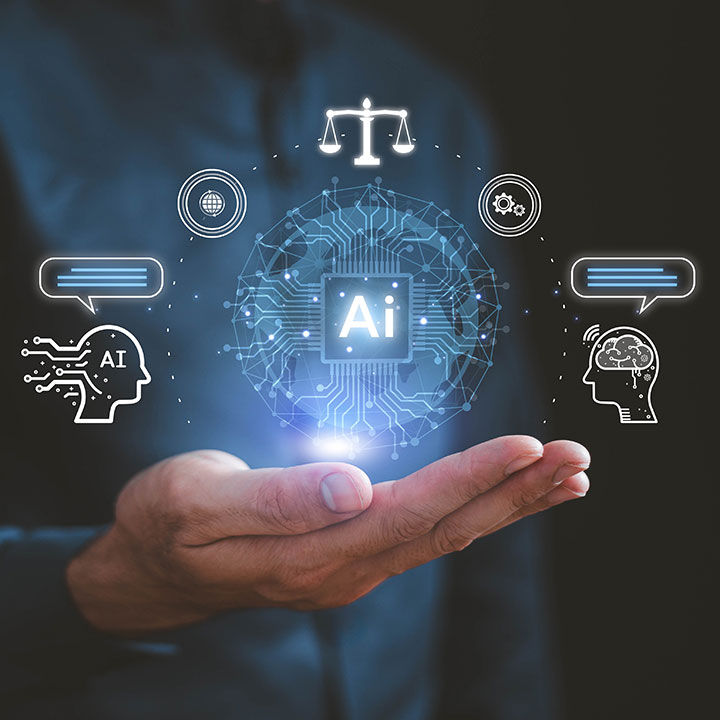Digitalisierung, bitte kommen: Auch der Behördenfunk braucht eine Zeitenwende


Der Behördenfunk steht vor einem Wendepunkt: Während Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr oder der Notfallsanitäter noch immer mit veralteter Technologie funken, verspricht die neue Bundesregierung einen digitalen Aufbruch. Doch die Haushaltspläne 2026 offenbaren eine komplexe Gemengelage aus Zuständigkeitsverschiebungen, ehrgeizigen Plänen und begrenzten Mitteln.
Nicht erst durch die sich verschärfende Sicherheitslage im Inneren, die neben bekannten Gefährdungen auch vermehrt hybride Bedrohungen wie Drohnenangriffe umfasst, ist klar, dass sich die Einsatzbereitschaft von Behörden und kritischen Einsatzkräften einer neuen Realität stellen muss. Das bedeutet auch: Im Krisen- oder Konfliktfall müssen sie sicher, zeitgemäß und schnell kommunizieren können. Doch Deutschlands Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS oder kurz BOS) (öffnet in neuem Tab) kämpfen noch immer mit einem technologischen Anachronismus: Das schmalbandige TETRA-System (öffnet in neuem Tab) aus den 90er Jahren kann lediglich Sprache übertragen – moderne Anforderungen wie Live-Videostreams, Drohnensteuerung oder sichere Datenkommunikation sind unmöglich.
Koalitionsvertrag als Wegweiser, Haushalt als Realitätscheck
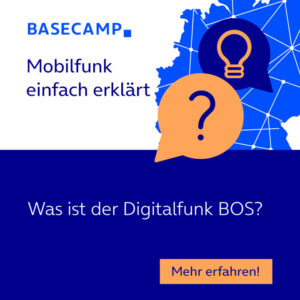 (öffnet in neuem Tab)Knapp drei Jahre nachdem der Verwaltungsrat der BDBOS das 4-Phasen-Modell (öffnet in neuem Tab) zur Weiterentwicklung des internen Digitalfunknetzes bekannt gegeben hatte, steht der Ausbau des Breitbandnetzes nun vor seiner nächsten Herausforderung: Ein Blick in den Koalitionsvertrag reicht, um festzustellen, dass die neue Bundesregierung zwar vage, aber ambitionierte Ziele für den BOS-Digitalfunk aufstellt: So ist die Rede von einer „besseren Finanzierung (öffnet in neuem Tab)“ und einem „eigenen UHF-Frequenzbereich (öffnet in neuem Tab)“, die den längst überfälligen Modernisierungsschub einleiten sollen. Doch bei genauerer Betrachtung offenbart sich ein Spannungsfeld zwischen Sicherheitsanforderungen und Nutzungsinteressen. Während einerseits dem BOS-Digitalfunk ein eigener Frequenzbereich zugesagt wird, heißt es an anderer Stelle (öffnet in neuem Tab): „Die terrestrische Rundfunkverbreitung schützen wir als kritische Infrastruktur. Das UHF-Band (öffnet in neuem Tab) steht auch Medien und Kultur zur Verfügung, die Abwägung mit Sicherheitsbedarfen wird derzeit evaluiert.” Hier wird schnell klar, dass noch weitere Spezifizierung notwendig ist, um Nutzungskonflikten zuvorzukommen. Die BDBOS fordert die Öffnung dieses Frequenzbereichs für den künftigen BOS-Breitbandfunk.
(öffnet in neuem Tab)Knapp drei Jahre nachdem der Verwaltungsrat der BDBOS das 4-Phasen-Modell (öffnet in neuem Tab) zur Weiterentwicklung des internen Digitalfunknetzes bekannt gegeben hatte, steht der Ausbau des Breitbandnetzes nun vor seiner nächsten Herausforderung: Ein Blick in den Koalitionsvertrag reicht, um festzustellen, dass die neue Bundesregierung zwar vage, aber ambitionierte Ziele für den BOS-Digitalfunk aufstellt: So ist die Rede von einer „besseren Finanzierung (öffnet in neuem Tab)“ und einem „eigenen UHF-Frequenzbereich (öffnet in neuem Tab)“, die den längst überfälligen Modernisierungsschub einleiten sollen. Doch bei genauerer Betrachtung offenbart sich ein Spannungsfeld zwischen Sicherheitsanforderungen und Nutzungsinteressen. Während einerseits dem BOS-Digitalfunk ein eigener Frequenzbereich zugesagt wird, heißt es an anderer Stelle (öffnet in neuem Tab): „Die terrestrische Rundfunkverbreitung schützen wir als kritische Infrastruktur. Das UHF-Band (öffnet in neuem Tab) steht auch Medien und Kultur zur Verfügung, die Abwägung mit Sicherheitsbedarfen wird derzeit evaluiert.” Hier wird schnell klar, dass noch weitere Spezifizierung notwendig ist, um Nutzungskonflikten zuvorzukommen. Die BDBOS fordert die Öffnung dieses Frequenzbereichs für den künftigen BOS-Breitbandfunk.
Parallel dazu beanspruchen Mobilfunknetzbetreiber Teile des gleichen Frequenzbereichs, da das UHF-Spektrum besonders gute Ausbreitungseigenschaften (hohe Reichweite und Gebäudedurchdringung) bietet, was ideal für ländliche Regionen geeignet ist.
Klarere Signale gibt es bei den Haushaltsplänen für 2026: Das Bundesinnenministerium erhält mit 16 Milliarden Euro einen Rekordhaushalt (öffnet in neuem Tab), eine Steigerung um über 800 Millionen Euro gegenüber 2025. Davon profitieren nicht nur die klassischen Sicherheitsbehörden mit 5 Milliarden Euro für die Bundespolizei und 1,24 Milliarden Euro für das Bundeskriminalamt, sondern auch die digitale Infrastruktur: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhält mit 379 Millionen Euro einen Ausgabenzuwachs von 231 Millionen Euro und verdoppelt somit fast seine Mittel gegenüber dem Vorjahr. Zusätzlich fließen über das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität weitere 2,25 Milliarden Euro (öffnet in neuem Tab) in den Breitbandausbau. Ob sich diese Haushaltsaufwüchse jedoch konkret in einer beschleunigten Umsetzung der BOS-Breitbandstrategie niederschlagen werden, bleibt abzuwarten, die finanziellen Voraussetzungen sind aber gelegt.
Zuständigkeitswirrwarr zwischen den Ministerien
Eine zentrale Herausforderung liegt in der Kompetenzverteilung. Der Organisationserlass vom 6. Mai 2025 (öffnet in neuem Tab) ordnet IT- und Netzkompetenzen neu: Mit der Gründung des Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) schafft sie einen mächtigen Akteur, der die „Zuständigkeit für die Netze des Bundes“ erhält. Allerdings bleiben die „spezifischen Anforderungen der Sicherheitsbehörden an die Netze“ beim Bundesinnenministerium (BMI). Diese Aufteilung könnte zu Koordinierungsproblemen führen, wenn es um die praktische Umsetzung des BOS-Breitbandnetzes geht.

Währenddessen intensivieren Telekommunikationsfirmen ihre Bemühungen, um das Kommunikationsnetz der BOS voranzutreiben. Jüngst wurden zum Beispiel neue, zukunftssichere Kommunikationslösungen (öffnet in neuem Tab) im Bereich Mission Critical Services (MCx) vorgestellt. Auch Network-Slicing Methoden sollen Einsatzkräften (öffnet in neuem Tab) trotz hoher Netzauslastung und besonderer Anforderung an die Sicherheit ermöglichen, was Mobilfunk-Kunden heute selbstverständlich erscheint: Jederzeit und verlässlich Fotos in Echtzeit zu versenden, Videostreams zu nutzen und Drohnenbilder live zu übertragen. Besonders in den letzten Monaten, war es öfter zu stundenlangen Ausfällen des Digitalfunks bei Feuerwehr und Polizei (öffnet in neuem Tab) gekommen. Hinzu kommt, dass die Interoperabilität zwischen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie die Kommunikation mit bereits vorhandenen TETRA-Funkgeräten (öffnet in neuem Tab) gewährleistet sein soll. Eine “virtuelle Rettungsgasse (öffnet in neuem Tab)” im Netz der Behörden soll entstehen.
Trotz dieser Entwicklungen gibt es Bedenken: Besonders vor dem Hintergrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage besteht weiterhin ein Risiko, sollte die Abhängigkeit von nur einem Provider für Deutschlands Sicherheitsbehörden bestehen bleiben. Ein möglicher Lösungsansatz liegt in einer branchenübergreifenden Plattform, die alle verfügbaren Netzressourcen intelligent bündelt und so mehr Resilienz, Verfügbarkeit und Flexibilität für Einsatzkräfte schafft. Statt regionaler Einzellösungen braucht es ein bundesweit einheitliches und sicheres System für nahtlose Kommunikation, das im Ernstfall zudem auch grenzüberschreitend funktioniert und die Koordination mit unseren europäischen Nachbarn ermöglicht.
Deutschland hinter der Welle
Während hierzulande noch technische und strategische Grundsatzfragen geklärt werden, sind andere europäische Länder bereits einige Schritte weiter: Schweden, Estland und Spanien beispielsweise betreiben seit Jahren erfolgreich ein leistungsstarkes Breitbandnetz (öffnet in neuem Tab) für Sicherheitsbehörden. Die kommenden Monate werden zeigen, ob auch Deutschland den Sprung ins Breitband-Zeitalter für seine Sicherheitsbehörden schafft. Doch die Koordination zwischen den Ministerien und den Bundesländern, die Klärung der Finanzierungsstruktur und die praktische Umsetzung bleiben entscheidende Hürden.
Besonders kritisch könnte dabei die Zeitplanung werden: Während die Industrie bereits 2026 (öffnet in neuem Tab)mit der Vermarktung beginnen könnte, haben die Behörden noch keinen einen konkreten Fahrplan für die Ablösung des TETRA-Systems vorgelegt. Es droht also weiterhin das Szenario, dass Deutschlands Behörden auch in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts auf Kommunikationstechnik aus den 90er Jahren angewiesen sind.
Die Weichen sind aber gestellt und die Dringlichkeit des Themas ist von allen zuständigen Stakeholdern erkannt: Mit mehr Geld im Haushalt, klarem politischen Willen im Koalitionsvertrag und state of the art technischen Lösungen von der Industrie ebnen den steinigen Weg zur modernen Behörden-Kommunikation
Mehr Informationen:
Am Ende jedes Artikel sollte eine kurze Infobox mit weiterführenden Links kommen. Zum Beispiel. Mehr über die Veranstaltung und die Teilnehmer:
Mobilfunk einfach erklärt: Was ist der Digitalfunk BOS? (öffnet in neuem Tab)
Weichenstellung für die Digitalpolitik: Das Digitalministerium bekommt eigenen Etat (öffnet in neuem Tab)
Die Funknetze der Zukunft: 5G und die Zukunft des Behördenfunks (öffnet in neuem Tab)