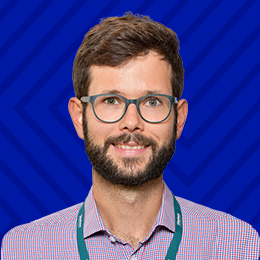Intelligenter Draht zwischen Stromanbietern und Nutzern


Die Energieversorger sehen sich selbst als digitale Nachzügler. Und als Nachzügler hat man natürlich viel aufzuholen – vor allem im Kontakt mit den Kunden. Während die Energieversorger früher nur einmal im Jahr – beim Ablesen des Stromzählers (öffnet in neuem Tab) – mit ihren Kunden zu tun hatten, soll es im Zeitalter der Smart Grids (öffnet in neuem Tab) und der noch smarteren Homes (öffnet in neuem Tab) nicht nur einen direkten, sondern auch einen intelligenten Draht zwischen den Stromanbietern und den Nutzern geben. Hinzu kommen die vielen Kommunikationskanäle, die für andere Unternehmen beispielsweise aus der Mobilfunk- oder der Konsumgüterbranche bereits selbstverständlich sind.
Kundenorientierung im Schnellkurs
Damit die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, um die Energieunternehmen näher an ihre Kunden heranzurücken, arbeitet die Bundesregierung derzeit am Verordnungspaket (öffnet in neuem Tab) „Intelligente Netze“. Damit wird unter anderem festlegt, wer überhaupt einen Smart Meter bekommt und wie intelligent dieses Lesegerät sein soll. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite steht die Frage: Wie bekomme ich Kundenorientierung in Unternehmen, denen bisher nur der Zählerstand ihrer Kunden vertraut war. RWE (öffnet in neuem Tab) sagt von sich „Wir sind da, wo unsere Kunden sind“ und geht mit einem internen Thinktank und einer extrovertierten Kundenkommunikation (öffnet in neuem Tab) über alle Social-Media-Kanäle (öffnet in neuem Tab) in die Offensive.
Schaufenster intelligente Energie
Wie es zukünftig aussehen könnte, wenn die Energiebranche „intelligent“ wird, das will die Bundesregierung (öffnet in neuem Tab) demnächst in einem groß angelegten „Schaufenster (öffnet in neuem Tab)“ testen. Was sich als Modell bereits bei der Elektromobilität (öffnet in neuem Tab) bewährt hat, soll auch bei der besseren Vernetzung von Energieerzeugern und -nutzern helfen. 80 Millionen Euro werden für das „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende“ (SINTEG (öffnet in neuem Tab)) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Verfügung gestellt. Am Ende soll eine „Blaupause“ für eine Zukunft entstehen, in der Erneuerbare Energien den Großteil des Stroms erzeugen.
EWE, SAP und Siemens
Für das BMWi-Projekt haben sich insgesamt sieben große Konsortien unter Beteiligung von rund 200 Unternehmen beworben. Im Herbst soll es in mindestens zwei Modellregionen losgehen. In diesen Unternehmensnetzwerken treffen kleine IT-Start-ups wie the peak lab (öffnet in neuem Tab) auf Branchenriesen wie SAP (öffnet in neuem Tab) und Siemens (öffnet in neuem Tab). Unter dem Namen „enera (öffnet in neuem Tab)“ haben sich beispielsweise mehr als 70 Partner zusammengefunden, um gemeinsam daran zu tüfteln, wie man mit den Möglichkeiten der Digitalisierung für Stabilität und ein verbessertes Zusammenspiel von Erzeugung, Verbrauch, Speichern und Netzen sorgt. Die Zusammenarbeit erfolgt aber nicht nur branchenübergreifend, auch Ländergrenzen werden überwunden, wenn sich Bundesländer wie Hamburg und Schleswig-Holstein als NEW 4.0 (öffnet in neuem Tab) zusammentun.
Die oft sehr ungleichen Partner im enera-Netzwerk haben sich unter der Führung von EWE (öffnet in neuem Tab) zusammengetan, um im Nordwesten (öffnet in neuem Tab) Deutschlands die Energiewende 2030 auszuprobieren. EWE bringt dafür nicht nur die Erfahrung aus der Energie- sondern auch aus der Telekommunikationsbranche mit. 40.000 intelligente Messsysteme sollen zwischen Aurich (öffnet in neuem Tab) und Emden (öffnet in neuem Tab) dafür sorgen, dass man Energie nutzt, wenn sie da ist. Das klappt aber nur, wenn die Verbraucher wissen, wann die Energie verfügbar und besonders günstig ist. Um die dafür notwendigen Informationen zusammenzubringen, werden auch im Energiebereich Informationsplattformen entstehen. Und so werden auch hier Daten immer mehr zum Geschäftsmodell.