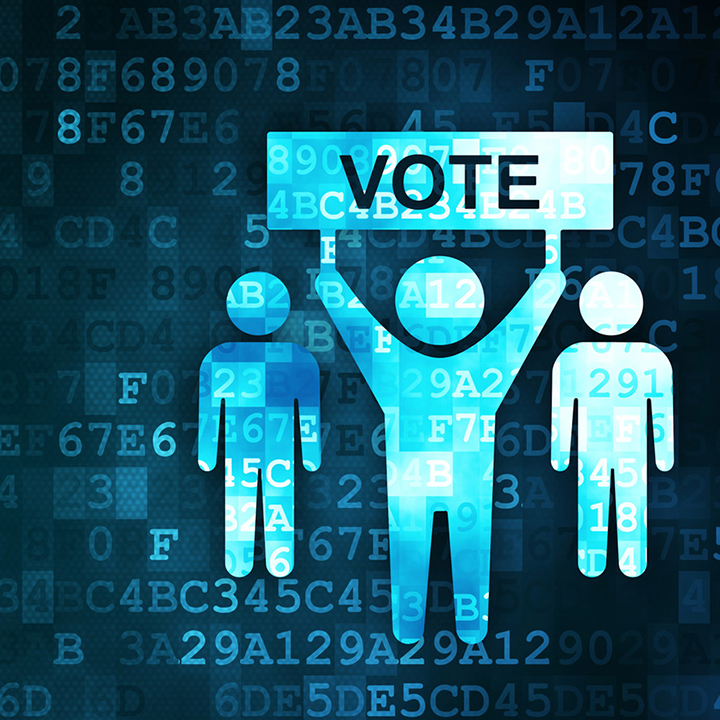Nutzungsbedingungen: Gelesen und akzeptiert!?


Autor: Uta Meier-Hahn
Name, Adresse, Aufenthaltsort: Wer Internetdienste nutzen will, willigt schnell in die Verwendung personenbezogener Daten ein. Doch welchen Wert hat der leicht gesetzte Haken in Zukunft?
“Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiere sie”. Dieser Satz ist schnell abgehakt und vergessen. In Wirklichkeit studieren wahrscheinlich die wenigsten die seitenlangen Ausführungen in juristischer Fachsprache, erst recht nicht auf dem Handy. Dabei beinhalten die Bedingungen meist Details, um die zunehmend gestritten wird: Bestimmungen zur Verwendung personenbezogener Daten. Das kann vom Namen über die Adresse bis zum aktuellen Aufenthaltsort reichen.
Hier geht es um den Haken und den Text dahinter, juristisch gesprochen: um die datenschutzrechtliche Einwilligung. Was ist das Problem damit, und welchen Wert hat sie in Zukunft?
Das Problem mit der Einwilligung
Will man der datenschutzrechtlichen Einwilligung auf den Grund gehen, landet man schnell bei den Grundfesten unserer Staatsordnung: Bei der Verfassung. Die Einwilligung ist nämlich ein Mechanismus, über den wir Grundrechte ausüben, zum Beispiel das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dieses Recht sichert “die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner Daten zu bestimmen”.
Konkret heißt das: Betroffene müssen freiwillig und informiert zugestimmt haben, bevor ihre personenbezogenen Daten verwendet werden dürfen. Juristisch sind diese beiden Attribute zentral. Denn wie freiwillig und wie wohlinformiert Zustimmungen erfolgen, steht in Zeiten allgegenwärtiger Online-Kommunikationsangebote und ständiger Datenerhebung stärker in Frage denn je.
Informiert entscheiden: Geht das in der Praxis?
Dass Vertragsbedingungen überwältigend sein können, ist im modernen Rechtsverkehr kein neues Problem. Doch beim Betreten von Online-Kommunikationsräumen betrifft die mögliche (Selbst-)Gefährdung nicht das Vermögen, sondern das Allgemeine Persönlichkeitsrecht. Beeinträchtigungen sind hier besonders schwer nachvollziehbar.
Die Nutzungsbedingungen von Facebook umfassen zum Beispiel mehr als 9.000 Wörter – im Fließtext sind das rund 15 DIN-A4-Seiten. Auf einem normalen Bildschirm liest sich das schon mühsam, auf Smart Phones hat es etwas Absurdes. Die wenigsten Nutzer werden wirklich wissen, womit sie sich einverstanden erklärt haben. Zwar gibt es Grenzen für den Inhalt solcher Bestimmungen – die Datenschutzgesetze der Bundesländer und das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen – doch diese bleiben vage.
Muss man sich vielleicht stärker den Nutzern zuwenden? Liegt es nicht in der Verantwortung des mündigen Bürgers selbst, sich zu informieren? Wer zu bequem ist, die Datenschutzbedingungen zu lesen, solle eben auf den Online-Dienst verzichten, meinen manche. An der gesellschaftlichen Realität geht dieses Argument allerdings vorbei: Selbst wer die häufig allgemein gehaltenen Bedingungen studiert, kann kaum realistisch einschätzen, was mit seinen Daten im Einzelnen passiert, gerade wenn er die Funktionen der neuen Kommunikationsplattform noch nicht kennt.
Freiwilligkeit auf der Kippe
Das größte Problem ergibt sich jedoch mit Blick auf die Frage der Freiwilligkeit. Längst üben wir fast alle Grundrechte auch im Internet aus, besonders Kommunikationsgrundrechte wie zum Beispiel die Vorbereitung von Versammlungen oder die Verbreitung von Aufrufen. Online-Foren, soziale Netzwerke oder Chat-Systeme zu benutzen, entzieht sich in diesem Sinn zunehmend der freiwilligen Entscheidung des Bürgers.
Die großen Internetdienste spielen dabei eine besondere Rolle. Denn je marktbeherrschender der Dienst, desto alternativloser erscheint dessen Nutzung für den Einzelnen, der andere Bürger mit seinem Anliegen erreichen können muss. Auch die realistische Chance, wahrgenommen werden zu können, gehört zu den Kommunikationsgrundrechten.
Für die Einwilligung gilt zwar grundsätzlich, dass sie nicht freiwillig ist, wenn sie unter Einfluss von Zwang oder Täuschung abgegeben wird. Beides trifft hier im engeren Sinne wohl nicht zu. Dennoch bleibt nicht viel übrig von der Idee der Freiwilligkeit, wenn die Wahl lautet, die eigenen Daten einer unübersichtlichen Verwendung preiszugeben oder auf die effektive Ausübung der Grundrechte zu verzichten. Zukunftstauglich klingt das nicht.
Am Donnerstag erscheint der zweite Teil dieses Artikels. Darin wird es konkreter: Es geht um denkbare praktische und juristische Lösungen für das Problem mit der Einwilligung.
Dieser Beitrag basiert auf der juristischen Erörterung zum Thema Datenschutzrechtliche Einwilligung von Julian Staben, Doktorand am Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft.