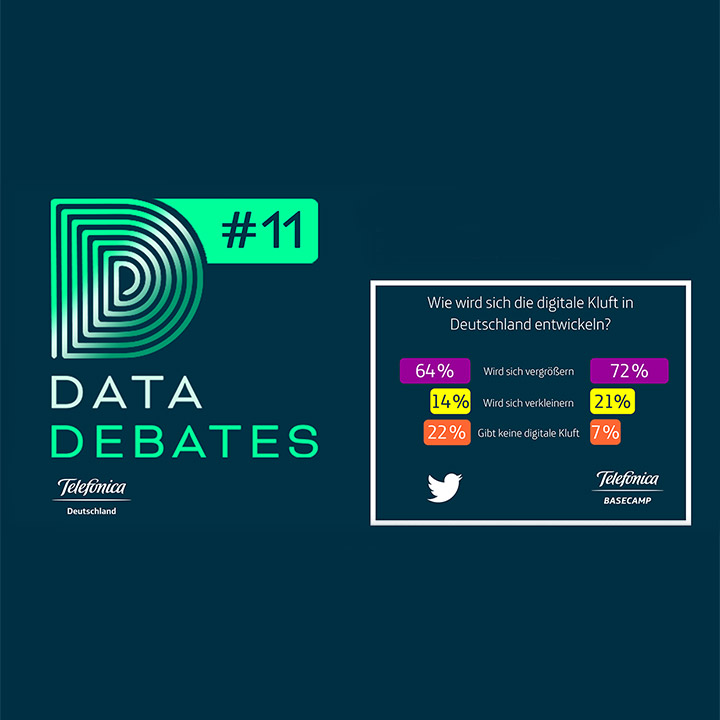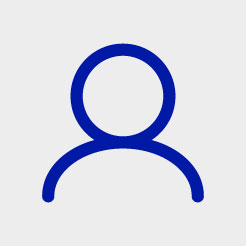Der Weg zur Digitalen Agenda 2014 bis 2017

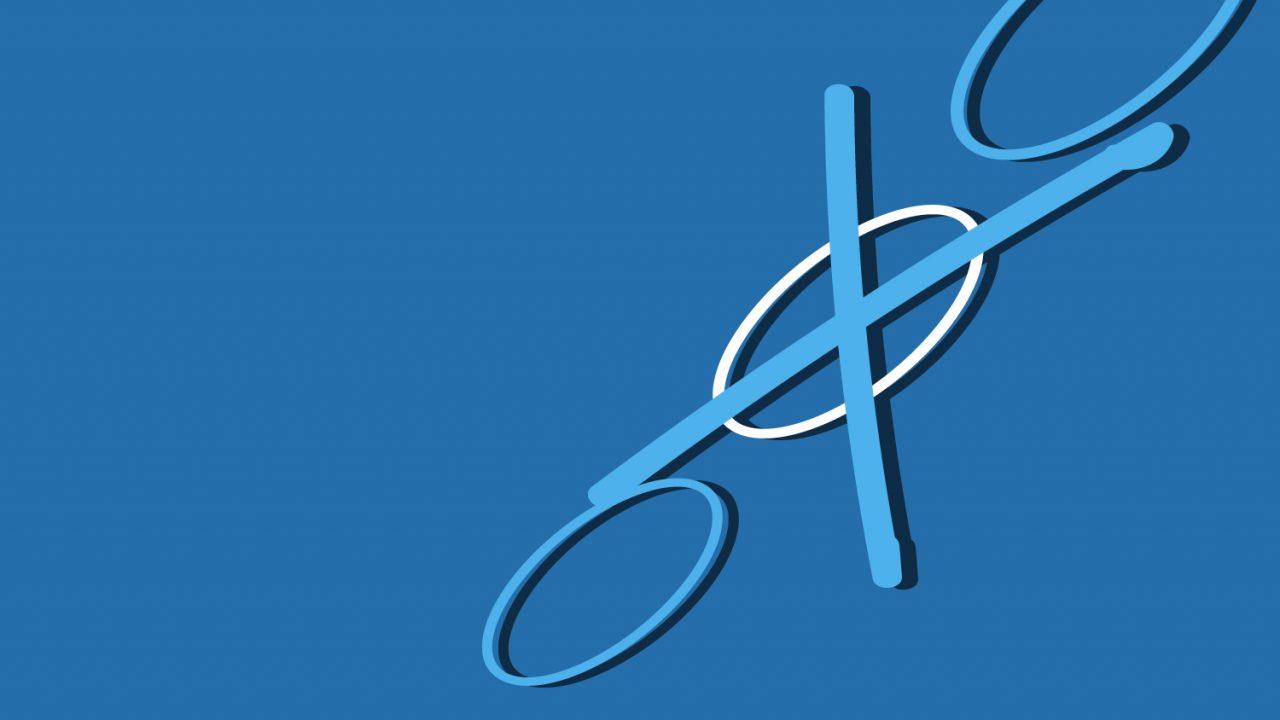
Am 20. August wurde die Digitale Agenda (öffnet in neuem Tab) im Bundeskabinett beschlossen (öffnet in neuem Tab). Im ersten Teil unserer neuen wöchentlichen Serie (öffnet in neuem Tab) zeichnen wir den Einzug der Netzpolitik in den Bundestag nach.
Grundstein legte die Enquete-Kommission
Drei Jahre lang – bis zum April 2013 – diskutierte die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft (öffnet in neuem Tab) über die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich durch die Digitalisierung ergeben. Mit Hilfe zahlreicher Experten erarbeiteten die Arbeitsgruppen umfangreiche Handlungsempfehlungen, die nun auf ihre Umsetzung warten. Die Ideen, die dort unter Beteiligung namhafter Politiker diskutiert wurden, fanden nach Abschluss der Enquete auch Eingang in die Wahlprogramme der Bundesparteien (öffnet in neuem Tab) zum Bundestagswahlkampf 2013. Zwar wurde der Netzpolitik noch unterschiedlich viel Platz eingeräumt – vor allem ließen die Formulierungen teilweise sehr viel Raum für Interpretation – doch sie hatte eine neue Position erobert. Im Koalitionsvertrag (öffnet in neuem Tab) zwischen CDU/CSU und SPD fanden sich schließlich so viele netzpolitische Punkte wie noch nie zuvor in einer Koalitionsvereinbarung. Daraus ließ sich schon das künftige Gewicht des Themas auf der politischen Agenda der 18. Legislaturperiode ableiten.
Der Einzug der Netzpolitik in den Bundestag
An einem Teilziel angelangt wähnten sich die Netzaktivisten in den Parteien, im Bundestag und außerhalb des Parlaments, als die Einsetzung eines eigenständigen Hauptausschusses Digitale Agenda (öffnet in neuem Tab) im Bundestag angekündigt wurde. Diese sichtbare Institutionalisierung der Netzpolitik im Parlament war von der netzpolitisch interessierten Zivilgesellschaft sowie von einzelnen Netzpolitikern aller Fraktionen besonders vehement gefordert worden.
Enttäuschung über die Arbeit an der digitalen Agenda
Die Netzpolitik der Parteien (öffnet in neuem Tab) hatte demnach – gemessen an der Geschwindigkeit der Digitalisierung – relativ lange Zeit sich zu entwickeln und so waren die Erwartungen aller Beteiligten groß, als die Bundesregierung ankündigte, einen Fahrplan für das digitalisierte Deutschland bis 2017 zu entwickeln. Doch sobald es sich um ein Querschnittsthema handelt, welches an Popularität und Aufmerksamkeit gewinnt, verlangen viele Ressorts ein Mitspracherecht (öffnet in neuem Tab). So kommt es, dass als Herausgeber im Impressum der Digitalen Agenda das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das Bundesministerium des Innern sowie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur stehen. Die Tatsache, dass beim Thema Cybermobbing auch die Bundesministerin für Familie und Jugend mitsprechen und sich beim Thema Medienkompetenz noch das Bildungsministerium einbringen will, macht eine Entscheidungsfindung über den zukünftigen Kurs nicht unbedingt einfacher.
Doch bei der Bewertung der digitalen Agenda handelt es sich häufig um ein Missverständnis, denn das vorgelegte Dokument ist kein Gesetz, das nun 1:1 umgesetzt wird. Vielmehr ist es eine Sammlung von Aufgaben, die in den nächsten Jahren entweder in nationalen Gesetzen und Verordnungen münden oder auf die lange Bank der EU-Regulierung geschoben werden können. Denn auf EU-Ebene wird ebenfalls an einem harmonisierten digitalen Binnenmarkt gefeilt. Dort ist die Größenordnung allerdings eine andere – schließlich wollen 28 Mitgliedsstaaten mit all ihren Regionen ihre vielfältigen Interessen einbringen.
Der vorstehende Artikel erscheint im Rahmen einer Kooperation mit dem Berliner Informationsdienst auf UdL Digital. Aylin Ünal ist als Redakteurin des wöchentlichen Monitoringdienstes für das Themenfeld Netzpolitik verantwortlich.